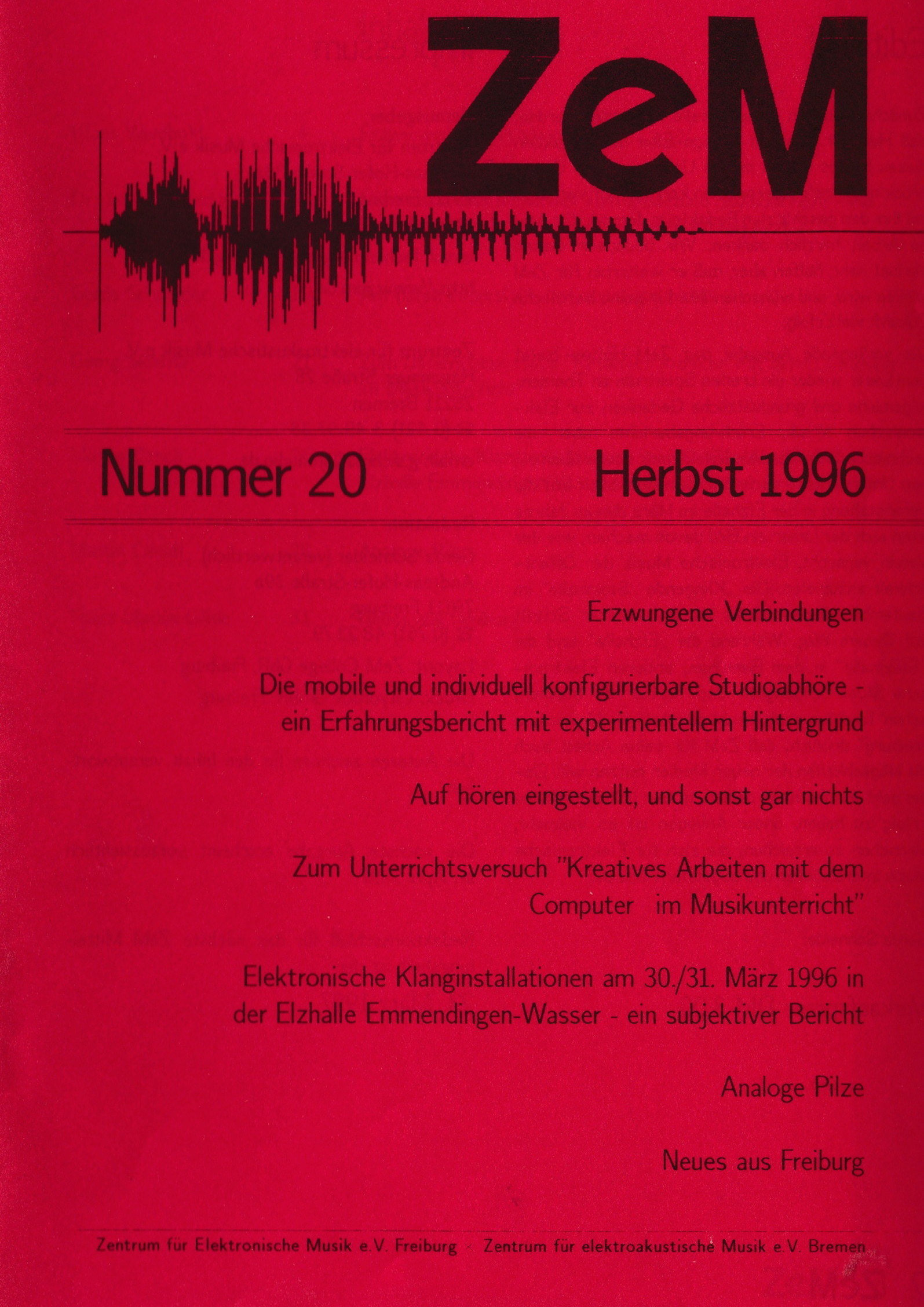 ZeM Heft Nr. 20 - Herbst 1996
Redaktion: Gerda Schneider
Zunächst muß an dieser Stelle mitgeteilt werden, daß
Herr Dr. Joachim Stange-Elbe die Redaktion dieses Heftes wegen seines Umzuges
nach Osnabrück nicht mehr übernehmen konnte. Wir verlieren mit
ihm den geschätzten Redakteur, dem wir für seine Arbeit herzlich
danken. Wir bedauern diesen Verlust sehr, hoffen aber, daß er weiterhin
für ZeM wirken wird, und wünschen ihm für seine berufliche
Zukunft viel Erfolg.
Gerda Schneider
↑Wie immer in unserem "Mitteileilungsblatt", stelle ich einige Gedanken zur Diskussion, die uns über unser Gebiet, die Elektronische Musik, Klarheit und geben und zu weiterem Nachdenken anregen sollen. Musik - als ich vor wenigen Tagen ein neu produziertes Samplestück mir vorführte, meinte ein Besucher an der Türe "Ach, Sie hören Musik". Offenbar ist also der spontane Eindruck beim Hören von elektronischen Soundproduktionen doch der, "Musik" zu hören. Ob dieser Eindruck beim weiteren Hören geblieben wäre, bezweifle ich. Wir nennen uns "Zentrum für Elektronische Musik", zunächst wohl deshalb, weil man sehr leicht für intentional produzierte Klangereignisse den Ausdruck "Musik" gebraucht, fragen uns aber immer wieder, ob diese Produktionen mit dem klassischen Begriff Musik kompatibel sind. Klangereignisse sind im Abendland in den letzten 3000 Jahren stets in Form von Musik produziert worden und bis heute besteht eigentlich in der ganzen Welt eine stillschweigende Übereinkunft darüber, was diese Musik systemlich und intentional, sachlich und persönlich sei. Die ersten Eindrücke beim Vorführen Elektronischer Musik, vielleicht bei den nächsten Angehörigen im Familien- und Bekanntenkreis waren oft anderer Art: "Das ist doch keine Musik" war eine der ersten Reaktionen, die man vor Jahren zur Kenntnis nehmen mußte. In der Tat, unsere Musik, unsere Musikerziehung, unser Musikleben ist von einer jahrtausendealten Tradition beherrscht, wir befinden uns im Gefängnis eines Systems, das seine Endgültigkeit gar nicht mehr zu beweisen braucht. In diese Situation treten nun neuartige, andersartige Instrumente, aus fernen Ländern oder aus dem eigenen Land, die plötzlich völlig andere Ansätze und äußere Erscheinungsformen dem erstaunten Benutzer zeigen. Gewiß erinnern z.B. Klaviaturen (Schlüssel) an Herkömmliches, gewiß erinnern Namen wie "Strings" oder "Organ" an Bekanntes, aber der Hintergrund führt in eine völlig andere, unverständliche, mit dem Herkömmlichen nicht zu vereinbarende Unterwelt, statt des Namens etwa C, heißt es plötzlich "Treiber" und "Resonator" oder "Connection" und "Formant". Offenbar tut sich hier am Ende des Jahrtausends eine neuartige Welt auf, die Frage ist, woher sie kommt, was sie will und wie sie u.U. die traditionelle Kultur verändern könnte. Die traditionelle Musik ist insofern sehr naturgebunden, als sie ein bestimmtes Prinzip dieser Natur voll ausnützt: Es ist das des unteren Teiles der Obertonreihe und das Prinzip, daß sich die natürlichen Elemente in ganz bestimmten Präferenzen zusammensetzen. Nicht jedes Element verbindet sich mit jedem anderen, Feindschaften, Sympathien und Anzüglichkeiten gibt es offenbar von Anbeginn der Welt unter den Elementen. Ein fest geordnetes System, dem wir uns nicht entziehen können. Eine Röhre oder eine Saite schwingt im Verhältnis 1:2, 1:3 usw.. Diese elementaren Verhältnisse stellen offenbar ein großartiges System einer natürlichen, nicht mehr zu hinterfragenden Ursprünglichkeit dar. Fragt man nun einen Naturwissenschaftler, etwa einen Chemiker, ob es auch andere Verbindungen geben könnte, so erhält man als Antwort, daß dies ginge und man diese dann als "erzwungene" Verbindungen, also vom Menschen geforderte bezeichnen kann. Die neuen Musikinstrumente erlauben dies nun auch, in jeder Frequenzmodulation kann die Verbindung 1: 1,9 hergestellt werden und im "Physical Modeling" kann die Verbindung einer schwingenden Saite in eine Röhre hergestellt werden. Die menschliche Stimme würde eine solche Verbindung innerhalb der natürlichen Körperoganisation nie erlauben. Das Fazit dieser Überlegungen ist, daß wir mehr als die Natur mit bisher unentdeckten Mitteln dieser Natur der Natur mehr auf quasi natürliche Weise entlocken können. Offenbar verbirgt sich hinter begrenzenden Präferenzen, wie sie die Natur vordergründig bevorzugt, ein weites Feld unbegrenzter Potentialitäten, diese können durch die modernen Musikinstrumente endlich erzeugt werden. In diesem Jahr wird die japanische Firma Kawai den neuen K 5000 Synthesizer auf den Markt bringen: 128 Obertöne, Hüllkurvenformung eines jeden dieser Obertöne, also eine neuartige Syntheseform, die in der Tat erzwungene Verbindungen herbeiführen kann und wird. Ob diese klanglichen Verbindungen der Menschheit gefallen werden, wird sich in den Auftragsbüchern der Firma Kawai in den nächsten Jahren niederschlagen. Die Musik, die Komposition hat eine physikalische, materielle Seite, über diese hat sich im Abendland eine grundlegende Philosophie gelegt, die des Idealismus. Nach dem großen griechischen Philosophen Plato steht die Idee am Anfang von allem, die Idee schafft sich die Möglichkeiten der Realisation in der Materie. Nach diesem idealistischen Ansatz war die Idee des Fliegens am Anfang da, und die Organe der Lebewesen mußten sich danach ausrichten. Ein anderer Ansatz besagt, daß keine Idee da war, aber daß Luft da war und Organe, die sich der Luft anpassen und dadurch das Fliegen ermöglichen konnten. In der klassischen Musikauffassung steht immer die Idee zu einem Werk am Anfang, und die Instrumente, Orchester oder Chor, und das vorhandene Musiksystem waren das Mittel, um die Idee zu realisieren. Am Anfang steht der Schöpfer, am Ende das Geschöpf, das Werk. Diese Richtung des Vorgehens ist umkehrbar: Am Anfang steht die Materie, das ungeformte Material, das vielleicht gar keine Ideen zuläßt, aber aus diesem Material können Ideen entstehen. Der grundsätzliche Unterschied zwischen abendländischem Idealismus und Materialismus wirkt sich in den neuen Instrumente und deren Produktionsmöglichkeiten fundamental aus. Die Musik ist in Lehrplänen bestimmten Bereichen zugeteilt worden, so im Abendland im allgemeinen dem sprachlichen Bereich, "Musik als Sprache". Musik spricht zu uns, ihre Grammatik verstehen wir, wir kommunizieren in der Sprache. Was Bach uns sagen wollte, verstehen wir, was die Romantiker uns sagen wollten, noch viel mehr, geträumt wurde immer, eine Träumerei ist jedem Menschen durchaus verständlich. Die neuen Instrumente verlassen die Sprache und führen zur Substanz, zur Natur, zur Grundlage, zu den Atomen zurück, diese Grundlagen sprechen nicht zu uns, sie sind einfach da. Eine Sinusschwinung ist keine Aussage, sie stellt ein Naturphänomen universellen Ausmaßes dar. So kann man sagen, daß die Elektronische Musik mit ihren Instrumenten "physikalisch" und nicht kommunikativ ist, daß sie "natürlich" und nicht "kultürlich" ist. Was Musik darstellt, ist in der Tat schwer zu sagen. Schon oft haben wir in diesem Blatt Bach zitiert, der darauf hinweist, daß Musik zur "Ehre Gottes" da sei und zur "Recreation des Gemüths". Diese Aussagen sind bis heute aktuell: Statt "Recreation" sagen wir heute "Therapie" und statt "Ehre Gottes" sagen wir heute "Ehre der Ausführenden, der Interpreten und der Komponisten". Elektronische Musik ist keine Therapie, sie vermittelt etwas völlig anderes: "Erkenntnis" der Natur und der natürlichen Möglichkeiten. Die Ehre Gottes wird zu einer Bewunderung der Natur, die es uns ermöglicht, "erzwungene" Verbindungen zwischen Schwingungen herzustellen, wie sie bisher die Natur noch nicht erzeugt hat. Wir können stolz darauf sein, am Ende des Jahrtausends in einer Zeit zu leben, in der diese Möglichkeit für uns konkrete Wirklichkeit geworden ist oder werden könnte. Konkret gesagt: Wir danken den japanischen Firmen, von denen hier nur die Firmen Tajo und Kawai erwähnt seien, für diese geschichtlichen Leistungen und Entwicklungen.
↑
Dr. Joseph MundiglDie mobile und individuell konfigurierbare StudioabhöreEin Erfahrungsbericht mit experimentellem HintergrundEs gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man eine Kontrolleinrichtung
installieren kann, die das möglichst objektive Abhören von DAT-Bändern,
digitalen Mischpulten, aber auch analogen Signalquellen gestattet und trotzdem
eine Anpassung an den persönlichen Hörstil ermöglicht.
Zweitens der Raum, den der Toningenieur durch die Wahl der Mikrophone
und deren Aufstellung gestaltet. Es ist zu bedenken, daß sich die
Mikrophonwahl auf die Abbildung der Schallquelle genau so auswirkt, wie
in der Photographie die Wahl des Objektives auf das Bild.
Drittens: Der Raum, der am Mischpult entsteht, ist also eine Auswirkung
der Aktionen, die dort ausgeführt werden und das ist in aller Regel
nichts anderes, als daß die effektive Lautheit der Signalquellen
verändert wird und diese Änderung hat physikalisch gar nichts
mit dem Spiel des Interpreten zu tun, denn wenn der Interpret lauter spielt,
kommt ein ganz anderes Klangbild zustande, als wenn am Pult der Regler
aufgemacht wird. Im Grunde ist so etwas ebenso unnatürlich, wie wenn
man die Waldsteinsonate statt in C in Cis-dur spielen würde und dann
die digitale Einspielung wieder von Cis nach C transponieren würde.
Wohl hinkt dieser Vergleich, aber im Endergebnis wäre alles "richtig".
Nur aus musikalischer, musikästhetischer Sicht ist das ein Ding der
Unmöglichkeit, ja eine "Verrückheit". Wer von den Durchschnittshörern
würde schon merken, was da gelaufen ist? Menschen mit wirklich absolutem
Gehör - und sie sind selten genug - würden wohl an der Temperierung
erkennen, daß da etwas faul ist. Ein Klavierstimmer, oder ein Konzertpianist
würde hingegen aus der Haut fahren wegen der musikalischen Unverträglichkeit.
Daß diese Verschiebung andererseits von Komponisten recht geschickt
zur effektiven Klanggestaltung genutzt wurde/wird, ist ein anderer, weil
authentischer Vorgang, z.B. das Höherstimmen der Geige bei Paganini,
Mahler und anderen, aber auch gelegentlich in der Zigeunermusik.
Viertens ist der Raum zu nennen, der durch elektronische Hilfsmittel (Effektprozessoren) entsteht. Dem ist vom HiFi-Standpunkt aus nichts hinzuzufügen, weil eigentlich unzulässig. Die Prozeduren reichen von der simplen Delay-Line, bis hin zu heute in Mode befindlichen DSP-Prozessoren - wir Musikelektroniker wissen damit wohl umzugehen, SONY aber auch. Und wenn man das minimale, aber eindeutige, ja typische Grundrauschen dieser Maschinen kennt, kann es vorkommen, daß man auf Klassik-LP's neueren Datums im Hintergrund Prozessoren werkeln hört, die gar nicht dahin gehören. Gerade bei Klaviermusik fällt es auf. Das ist schon eine Schwei..Schwindelei in Richtung ADA! Eine audiophile Rarität kann es trotzdem sein. (W) Fünftens ist der Raum zu nennen, der durch Änderung der Parameter
der Richtung, des Direktschalles, der Reflexionen und des Nachhalls aufgrund
verstärkungsspezifischer Einflußfaktoren entsteht. Hier kommen
auch Kabeleinflüsse besonders zum Tragen, weil sie durch Wellenwiderstand
und eine ganze Menge von Kriterien, wie Abschirmung, Eigenschaften als
Leiter einen bedeutenden Einfluß auf das Klangbild haben können.
Gemeint ist also das Zusammenspiel aller für die Wiedergabe beteiligten
Komponenten:
Sechstens: Der Raum, in dem abgehört wird, kann der Abhörraum im Studio sein, aber auch der Wohnraum eines Hörers, der einen Tonträger erworben hat. Je mehr Parameter aus dem Konzertsaal ideal übertragen werden, um so mehr Hörfehler werden beim Rezipienten aufgrund biophysikalischer Faktoren ausgeschlossen, wenn am Ende der Empfangskette die Möglichkeit besteht, einen Großteil der Parameter so zu rekonstruieren, zurückzugewinnen, wie sie im Konzertsaal waren. Aus diesen Gründen braucht jemand, der über das Richtig oder Falsch, Verträglich oder Unverträglich entscheiden soll, eine mobile Abhöre, die er auf sich zuschneiden, trimmen kann. Aber nur permanente Kontrolle und Korrektur im Langzeittest führen zur unbestechlichen Höreinheit. Oft bringen da auch nicht immer Modellwechsel der Komponenten sinnvolle Verbesserungen. Für die exakte Beurteilung ist eine optimale Signalführung
zum Trommelfell Voraussetzung. Also ist es nun notwendig, ein System aufzubauen,
das die Kontrolle des Signals unmittelbar am Digitalausgang eines CD-Players,
DAT-Recorders etc. ermöglicht. Dabei zeigt sich, daß der sogenannte
Räumlichkeitseindruck nicht zwangsläufig von der Anzahl der Chassis
(Quadrokopfhörer und ähnliche) im Kopfhörer abhängt,
sondern auch von deren Frequenzgang und der Membrangröße. Der
Jecklin-Float hat eine extrem große Membran, das heißt, er
bezieht im Gegensatz zum Grado HP2 Signature einen Teil der Kopfoberfläche
in das Abstrahlfeld mit ein, spricht also die Knochenleitung stärker
an und damit die Parameter höherer Frequenzanteile, die für die
Ortung "vorne" verantwortlich sind. Damit rückt das Klangbild aus
der Im-Kopf-Lokalisation heraus. Es wird vielfach vergessen, daß
auch bei der Lautsprecherwiedergabe eine Im-Kopf-Lokalisation stattfinden
kann, was rein pysikalisch schon ein Widerspruch zu sein scheint.
Bei Plenge ist aber auch der Beweis dafür zu finden, daß sich Tester durch die Tests selbst manipulieren (müssen), dies vor allem beim Test von Schallwandlern, weil der Langzeitspeicher permanent unter dem Einfluß des Kurzzeitspeichers und des momentanen Schalleindrucks steht. Aus diesem Grund kann eine Rang- und Namenliste auch eine Dokumentation dieses Manipulationsvorgangs - selbst einer Personengruppe - sein. Das heißt, auf die Aufnahme bezogen, der Erfahrungshintergrund von Tonmeister A kann völlig anders sein, als der von Tonmeister B. (Beispiel: Haydn Gesamtedition, Die Streichquartette, DECCA 1974, man höre die Vielfalt der tonmeisterlichen Klangauffassungen innerhalb der Gesamtedition und vor allem den sorglosen Wechsel der Mikrophonbestückung auf den einzelnen Platten, ganz besonders auffällig in Vol. 3. Und noch ein Beispiel für die nachgerade so hochgelobte Sorgfalt der Tonmeisterei in Vinylzeiten sind manche Aufzeichnungen von Van-Cliburn-Konzerten mit Orchester, bei denen derart an den Reglern gezogen wurde, daß sich im Orchester eine regelrechte Völkerwanderung vollzieht. Es läßt sich trefflich darüber nachdenken, ob in der Regie damals nicht eher brave, solide, notentexttreue Handwerker saßen, als hifidele Überphilosophen.) Problem der Wiedergabetechnik ist es nun, beide Soundaspekte mit audiotechnischen Mitteln so "auf die Reihe" zu kriegen, daß die Absichten und Ansichten beider Tonmeister in Bezug auf die Intentionen des Interpreten dem Hörer vermittelbar sind. In jeder Plattensammlung gibt es Extreme. Und es ist im Interesse einer vernünftigen Rezipierbarkeit zu fragen, was nun besser ist, eine Abhöre, die durch Perfektion der Mittel diese Extreme pur, UNVERMITTELT zu Gehör bringt, oder eine, die durch sympathische Schwachstellen, oder geschmacksbezogene Tarierung, eben durch die zur Vermittlung beitragenden physikalischen Unschönheiten die klangliche Offenlegung einer Interpretation in für den Hörer rezipierbarer, weil akustisch verdaulicher Form anbietet. Zweifellos steht hier die absolute Physik gegen die Ästhetik und das mag mit eine Problematik von analog und digital sein und warum man beide eben nicht in einen Topf werfen darf, denn dann entsteht im Urteil nicht eine Ungerechtigkeit gegen das Analoge oder das Digitale, sondern gegen die Physik. Das aber kann eine Perversion sein. Dann schaffen wir das Zeug ab und musizieren selbst. (Und unsere Literaturkenntnis ist wieder auf mittelalterlichem Niveau, denn, wenn ein Musikstudent die 4. von Mahler kennen lernen muß, weil der Prof. darüber spricht, ist es egal, ob das digital oder analog geschieht. Entscheidend ist dann, welche Partitur er in Händen hat.) An einem Beispiel aufgezeigt, geht es also darum, daß ein Musikstudent
des Fachs Klavier eine Aufnahme einer Klaviersonate mit dem Notenblatt
in der Hand verfolgt, sie realiter nachvollziehen kann, und nicht an wiedergabetechnischen
Querständen scheitert, die eine exakte Klangdefinition verhindern,
möge die Technik auch noch so hochgelobt und teuer sein.
Das Digitalsignal liegt meist an zwei Ausgängen vor, dem TOS-Link-Lichtleiterausgang und dem Coax-Digitalausgang. Ganz richtig ist der Begriff Coax nicht. Er wird hier stellvertretend für Cynch, Cinch, Chinch, BNC und RCA verwendet. Coax ist eine Kabelbezeichnung und das andere sind Steckernormen, mit denen Coax angebunden wird. Also bleibt es hier bei Coax-Kabeln und wie sie angebunden sind, ist eine Wahl des Steckers, bzw. entsprechender Adapter. Bei den Adaptern ist Vorsicht geboten, weil generell Übergangsstörungen zu befürchten sind. In den CD-Anfängen wurde TOS-Link hochgelobt, man glaubte die bestmögliche Signalform vorzufinden. Inzwischen hat man herausgefunden, daß dieses Signal sich weit schlechter darstellt, als das Coax-Signal. Grund dafür ist, daß das Signal für TOS-Link pro Gerät (sendendes und empfangendes) noch einmal gewandelt werden muß. Außerdem gibt es bei den Lichtleitern selbst erstaunliche Unterschiede in der Übertragungsqualität, fast ähnlich denen bei NF-Leitungen, aber nicht ganz so dramatisch, trotzdem deutlichst hörbar. Im Vergleich zu Coax ist TOS-Link für High-End mit Vorsicht zu handhaben. Daher unverständlich, daß ALESIS ADAT davon nicht abgeht. Zumal ADAT ein eigenes Format verwendet und das Alesis AI-1 notwendig ist, damit man überhaupt externe Wandler anschließen kann. Das TOS-Link muß also unbedingt auf Coax überführt werden, damit es nicht wieder auf den TOS-Link der zweiten Maschine trifft (TOS). In manchen Fällen kann man den TOS-Link-Ausgang dadurch umgehen, daß man schlicht vorher auf BNC abzweigt. Wo das nicht geht, bietet Audio Alchemy (folgend als AA bezeichnet) den Data Stream Transceiver (DST) an, der TOS-Link auf Coax bringt. Eingangsseitig hat man wahlweise Coax und TOS-Link Eingänge. Damit kann man auch an alte Geräte heran, die nur TOS-Link bieten. Ausgangsseitig findet sich Coax. Die Leitung ist aktiv, mit einem Steckernetzteil als Stromversorgung. Alle AA-Bausteine haben diesen Versorgungsweg. Im Sinne einer wirklich optimalen Spannungsversorgung wären aus mehreren Gründen Akkus vorzuziehen, deren Strom weitaus sauberer ist - ein Vorteil mobiler CD's und DAT's - und man kann netzunabhängig arbeiten, bekommt also nicht die Störquellen im Studio auf den Wandler. Strenggenommen kommt man um den DST nicht herum, wenn TOS-Link auf Coax überführt werden soll, weil alle TOS-Link-Anbindungen Schwachstellen sind und man am Digitalwandler (oder Jitter-Killer AA/DTI) direkt auf Coax kommt. Ein ernster Hinweis: Bei der Verwendung des AA-DST am TosLink-Ausgang eines CD-Players kann es in einem benachbarten UKW-Analogtuner zu massivsten Einstreuungen kommen. Dadurch bricht das Stereosiganl im Tuner restlos zusammen. Aber: Wer hört im Tonstudio schon Rundfunk und komponiert dazu? Trotzdem ist das mit den Einstreuungen eine unschöne Geschichte, weil es ratsam ist, die Wandlerequipment permanent unter Strom zu halten, damit das klangliche Arbeitsniveau nicht absinkt. Und noch ein Schönheitsfehler. Auch der DST ist nicht für ADAT tauglich, da er nicht alle Signalformate verarbeiten kann. Die Signalfolge aus dem DST kann wegen der ersten Wandlung im Wiedergabegerät
und eventueller Unregelmäßigkeiten des Laufwerks bei der Abnahme
am TOS-Ausgang nur bedingt ideal sein. Ein "Schrittmacher" muß sie
wieder so ordnen, daß sie die für den Digital-Analog-Wandler
geeignete Paßform haben, denn gerade die Unregelmäßigkeiten
eines alten CD-Laufwerks machen dem DA-Wandler enorm zu schaffen und je
häufiger die Fehlerkorrektur einschreiten muß, um so mehr wird
das Signal "verbogen". Es entstehen regelrechte Artefakte, die eigentlich
signalfremd sind, weil die Fehlerkorrektur nicht exakt genau wissen kann,
wie das ideale Signal aussehen sollte, also wohin es wandeln soll.
An dieser Stelle, kann das Signal zum Abhören verwendet werden, es liegt analog vor und gelangt in der Regel in einen Vorverstärker, Verstärker usw. Hier besteht aber auch berechtigte Neugier, wie denn nun das Signal akustisch ohne Beeinflussung irgendwelcher negativer Verstärkungsfaktoren, Lautsprechereigenheiten, Verzerrungen, Phasendrehungen durch Frequenzweichen, Membraneigenschwingungen, Gehäuseresonanzen, Raumreflexionen, mitschwingenden Möbel(erb)stücken, usw., aussieht, sich anhört. Es ist ein Kopfhörer zu suchen und zu finden, der klanglich ganz
oben angesiedelt sein muß (S) und ganz wenig Leistung braucht, weil
ja noch zwischen Wandler und Kopfhörer eine passive Regeleinheit geschaltet
werden soll, denn bislang existiert keine Möglichkeit, die Lautstärke
anzupassen (A).
Monomitte und Stereomitte unterscheiden sich von "Nase vorn", fallen also unterschiedlich aus. UND: Wenn man diese Gewichtung nicht kennt - das AMADEUS-Quartett spielt ganz anders als das AURYN-Quartett - wäre im Zweifelsfall aus der Sicht der Interpretation glatt eine Monoaufnahme einer Stereoaufnahme vorzuziehen. Für die Praxis bedeutet das, wenn der Tonmeister das AURYN-Quartett genauso behandelt, wie das AMADEUS-Quartett, verpatzt er die Interpretation, egal ob analog oder digital gemastert wird. (H) Solche Entscheidungen sind wichtiger, als endlose Bit-Diskussionen,
oder die Frage, ob nicht technologisch parallele Gedankenspiele zu Quantisierungsdebatten
letztlich zur der zweifelhaften Überlegung führen, wie die Granulatdichte
im Vinyl die Interpretation beeinflußt.
Die Abstimmung eines Kopfhörers ist wesentlich schwerer als die
Abstimmung eines Lautsprechers, weil der Kopfhörer in der Wiedergabe
der klangbestimmenden Parameter ungleich genauer ist.
Es folgt die Beschreibung einiger Anwendungsfälle aus der Tonstudiopraxis.
Daß dabei Maschinen erwähnt werden, die aus allen möglichen
"Jahrgängen" stammen, ist nur natürlich. Im Falle der CD-Player
ist es sogar sehr empfehlenswert, einen veralteten internen Wandler durch
einen jüngeren externen zu ersetzen, als den kompletten Player wegzugeben,
obwohl das Laufwerk noch voll seine Dienste tut.
Geeignet zur klanglichen Anpassung ist z.B. das Kabel "Mseries M 350
High Resolution Audio Interconnect Cable with Magnetic Flux Tube" oder
auch das "Restec 7N Copper Audio Cable", wobei zu beachten ist, daß
das Restek weit teurer ist, als das Mseries.
Zwei praktische Beispiele: An einer McIntosh Vorstufe (z.B. C 29, für Kenner einer der besten McIntosh) wird man den Grado mit Mseries anbinden. An einem Luxman kann man den Grado anbinden, wie er ist. An Audio Alchemy liegt für Grado die gestackte Kabelführung nahe, weil der Lautstärkeregler eingebunden werden muß, die Wandler selbst genau in der goldenen Klangmitte liegen, der Grado deshalb durch das Mseries M350 in den Tiefen etwas gebremst werden muß. Schließt man an die Ausgänge der Wandler eine Röhrenendstufe an, die entweder einen Jecklin-Float, oder einen AKG K 1000 treibt, ist die gestackte Kabelführung nicht unbedingt notwendig, da die Röhre zwar eine etwas dunkle, beide Kopfhörer aber eine durchwegs helle Klangzeichnung bringen. Nachteilig beim Jecklin-Float ist, daß im Signalweg zwei Feinsicherungen für die elektrostatischen Membranen liegen, tauscht man diese gegen je zwei cm lange Lautsprecherleitung aus sauerstoffreiem Kupfer mit großem Querschnitt, wird die aggressive Helligkeit aufgehoben. Das ist ein Eingriff in das Gerät. Damit verlieren Sie Garantieansprüche und verstoßen gegen VDE/TÜV/CE-Verordnungen. Das kann auch eine strafbare Handlung sein, wenn andere dadurch zu Schaden kommen. Der Hörer aber klingt wesentlich satter und angenehmer. Auch beim AKG kann man Überlegungen in diese Richtung anstellen, zumal das Steckermaterial im Fachhandel zu haben ist. Versuche mit Kabel vom französichen Hersteller FADEL lohnen sich durchaus. Auch "Öhlbach T.M. 2x4" oder "Phonosophie LS 2" können geeignet sein. Der Signalweg des Verfassers an einer modifizierten (Greiner/Regensburg) Röhren-Ampliton sieht für den Jecklin wenigstens so aus, daß das Analogsignal direkt aus dem AA-Wandler auf das dazwischengeschaltete Potikabel (Völkner) gelangt, aus der Stereo-Klinkenbuchse mit "Monitor Silver Highflex" (2x10cm!) auf zwei Cinch geführt wird, mit Restek/7N (1m) zum Feinstabgleich auf zwei Schiebepotis geht und von dort über das wirklich dunkle Etalon-Cinch (2x1m) auf die Endstufe trifft, an welcher der Float hängt. Bei diesem direkten Weg vom Wandler auf die Endstufe ist bei manchen Einspielungen, die generell sehr zur Helligkeit neigen, ein wirklich nur minimaler Anflug von Rauhigkeit zu hören. Bei diesen CD's führt der Weg - siehe Zeichnung - vom AA-DDE-V 1.0 über das Kabel WBT-2020 CCS (1,5m) zur McIntosh-Vorstufe-AUX 1 und aus dessen Kopfhörerausgang über Mseries-M350 auf das Potikabel von Völkner. Den AA-DITB (für Klaviermusik - siehe Zeichnung) habe ich geringfügig härter über "monitior CABLE OFC SYMMETRY AUDIO RESPONSE" (1,5m) an McIntosh- AUX 2 angebunden. So kann man beim Hören zwischen zwei Wandlern wählen und auch DAT optimal herüberbringen. (Man könnte noch Digitalrundfunk mit hereinnehmen, aber das wollen wir erst gar nicht diskutieren.) Der Weg vom McIntosh geht dann wie oben beschrieben über M350 weiter. Generell halte ich diesen Weg für ideal - wenn man nicht mobil sein muß. Die Kabellängen ergeben sich auch aus dem Bemühen, die Digitalelektronik unbedingt von der Analogtechnik fernzuhalten. Die Wandler, direkt auf den Geräten liegend, klingen weit schlechter, als wenn sie räumlich isoliert sind. Auch die Netzteile sind sorgfältig ausgelagert und Stromzuführungen liegen sowieso strikt abseits aller Signalleitungen! Wenn die Übergangsstellen von Kabelverbindungen (Wahl der Steckverbindung) zur "Klangkorrektur" mit verwendet werden, sind selbst an diesen Stellen spektrale Verschiebungen möglich, die sich nicht zwangsläufig in meßbaren Linearitätsbeeinflußungen festmachen lassen, aber deutlich wahrnehmbar sind. Kabelstacks eignen sich regelrecht als Ersatz für eine Klangregelung, wenigstens im Einzelfall: Phasengeschichten, wie sie elektronische Klangregelungen machen, fallen weg. Dennoch können auch Kabel die Phase beeinflussen, nicht aber in demselben, also gleichen Masse wie aktive Klangregelungen. Beide Einflüsse sind auch generell nicht vergleichbar, da sie sich physikalisch im musikalischen Zusammenhang, also im Zusammenhang mit der Reproduktion von Schallabläufen anders darstellen und verhalten (können). Auch wenn für beide die gleichen physikalischen Gesetze gelten, ist ein Unterschied zu machen, wie oft eben ein physikalisches Gesetz im Einzelfall angewendet wird - und das geschieht in einer elektronischen Schaltung häufiger, als in einem Stück Draht. An diesen Beispielen kann man erkennen, daß bei der Anpassung von Kopfhörern an Wiedergabeeinheiten selbst der Spitzeklasse alles drin ist, von wirklich messerscharfer Genauigkeit, die Klaviermusik halsbrecherisch überzeichnet, daß man glaubt regelrecht zwischen den Saiten zu sitzen, bis hin zur filigranen Seidigkeit, die z.B. das Quartettspiel zu intimster Homogenität führt, während dieses in einer unglücklichen Anpassung auseinanderfällt, die Musiker nebeneinander her spielen, als ob sie zerstritten wären. So kann die Wahl der Wiedergabemittel eine Interpretation beeinflussen und welchen Wert Plattenrezensionen unter Vernachlässigung der Angaben zur Abspieleinrichtung haben, ist eine Geschichte für sich. Den Rang- und Namenlisten in Fachzeitschriften muß man daher mit größter Skepsis begegnen, oft sind definitive Aussagen sinnlos, da durch Kabeleinflüsse wirklich gravierende Verschiebungen eintreten können. Hier ein Negativbeispiel, das aber nicht unbedingt generell als solches zu werten ist, sondern den Einfluß der Signalleitungen auf das Erscheinungsbild einer Interpretation eindrucksvoll bestätigt. Signalweg: TosLink von CD -> 5cm Glasfaser -> AA/DST -> DITB -> Restek/NF 1m -> "Monitor"-Übergang (Highflex/Silber 2x10cm) auf Stereo-Klinke -> M35O 1,5m -> Potikabel von Völkner Elektronik -> Grado HP 2 (Der häufige Kabelwechsel kommt auch deshalb zustande, weil Übergänge auf verschiedene Kabeltypen zu schaffen sind. Idealerweise könnte man auch löten.) Ergebnis: Das Klangbild zerfällt in Einzelaktionen. Beispiel: Beethoven Violinsonaten mit Kremer und Argerich (Deutsche Grammophon). Beim Hören stellt man sich verzweifelt die Frage: "Warum musizieren
die nicht zusammen?". Man hat den Eindruck, jeder spielt seinen eigenen
Part für sich. Das Klangbild ist spektral so überzeichnet, daß
selbst kleinste Unregelmäßigkeiten in Klavierläufen dramatisch
hervorgehoben werden. Das Spiel verliert jede Eleganz und Musikaliät.
Das Klangbild ist so "überattackig", daß jede Homogenität
des Spiels verloren geht. Der Zusammenhang fehlt.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Wandler out -> NF-Cinch auf Stereoklinke -> Mseries -> Völkner/Potikabel -> Grado HP2. In diesem Fall war auch eine TOS-Link-Anbindung unter High-End-Aspekten möglich. Es ist nach Meinung des Verfassers die beste Abhörmöglichkeit,
wenn man beweglich sein muß. Zudem befaßt sich Audio Alchemy
mit Stromversorgungen auf Akkubasis, was der weiteren Netzunabhängigkeit
und Tonqualität zugute kommt.
Kabel können also wesentlichen Einfluß auf das Klanggeschehen
nehmen. Für die Bewertung einer Interpretation muß aber vor
allem die Verzerrung der dynamischen Schattierungen ausgeschlossen werden.
Leider wird dies in kaum einem Test zur Sprache gebracht und ist doch so
entscheidend für die Faßlichkeit einer Interpretation. Das betrifft
analoge Wandler (Tonabnehmer für Vinyl) genau so wie digitale.
Für den Komponisten bedeutet dies: Wer falsch hört, komponiert falsch. Wer mit übertriebener Klangzeichnung hört, untertreibt beim Komponieren - über Lautsprecher klingt das Ergebnis fahl, flach, leblos. Umgekehrt gilt das natürlich auch. Ohne die Absicht irgendeiner Werbung habe ich den Maschinen von AudioAlchemy gegenüber vielen anderen den Vorzug gegeben, weil sie fürs Geld die werktreueste Abbildung einer Interpretation ermöglichen. Das ist man in musikalischer Ehrlichkeit und Fairness dem Interpreten schuldig und macht dem Komponisten Ehre. Und dabei halte ich den allerersten Wandler aus dem Jahre 1991 für den ganz gewiß nicht schlechtesten, konnte er auch nicht sein, denn er hatte mit den frühen CD-Playern zu tun und machte diese unzivilisierten Gesellen einigermaßen hoffähig. Deshalb ist es nur anzuraten, ein altes DAT nicht auszuwechseln, solange das Laufwerk mitspielt, sondern die Maschine über eine hochwertige Wandlerkonfiguration laufen zu lassen und vom DAT nur das Bandlaufwerk zu nutzen. Bei ADAT geht der Weg über AI-1. Angesichts der vielen Samplefrequenzen im Studiobereich (Elektronische Musik) wäre zu wünschen, daß nachgedacht würde über eine Wandlerkonstruktion, die, ähnlich einem sich selbst anpassenden Netzteil, das ankommende Format selbst erkennt und somit für alle Maschinentypen geeignet wäre. Es wurde versucht die Signalwege sehr genau zu beschreiben, weil selbst zwei Zentimeter Kabel ein Klangbild entscheidend beeinflussen können (siehe Modifikation Jecklin-Float). Auf Lautsprecherwiedergabe ist diese Beschreibung nicht ohne weiteres übertragbar, dies sei nur gesagt, daß keine Mißverständnisse entstehen. Beim Nachvollzug bin ich gerne zur Hilfe bereit. Meine Anschrift erfahren Sie bei den Redaktionen.
Fußnoten und Anmerkungen Abkürzungen:
(A) Es gibt einen ausgezeichneten Wandler von AA mit (ferngesteuerter) Lautstärkeregelung. Der stand für diesen Bericht nicht zur Verfügung - aus pekuniären Gründen - man denkt an Achternbusch und viele andere. (B) Vielleicht zeigt uns Bonn heute bewußt die Gründe auf, warum Komponisten vom Notenblatt zur Schweinezucht und ähnlichem wechselten. Dann sollen die Damen und Herren dort kollektiv fetten Saumagen schmatzen, anstatt Haydn hören. (G) Er ist für einen dynamischen Kopfhörer astronomisch teuer, glauben Sie es bitte und denken Sie daran, bevor Sie einen HiFi-Laden betreten, denn Sie wollen ja nicht unangenehm auffallen, wenn man Ihnen den Preis nennt. Bedenken Sie auch, es gibt noch teurere, aber auf Lebenszeit gerechnet ist er billig und man braucht keinen weiteren mehr, weil alle anderen schlechter oder sonst irgendwie für unser Vorhaben unbrauchbar sind. Denn entweder brauchen Sie ein E-Werk zum Antrieb von Systemen wie Jecklin-Float oder manche von STAX, auch AKG K 1000 und sind daher nicht netzunabhängig transportabel, oder sie sind so miserabel (Hörer für Walkmen, die brauchen wenig Leistung), daß sie nicht einmal der Papst aus Mitleid aufsetzen würde. (H) Die Diskussion ist also vorrangig nicht, ob Horowitz analog oder digital gehört wird, sondern, daß Thomas Frost der ideale Tonmeister für ihn war und es verstanden hat, sein facettenreiches Klangspiel so festzuhalten, daß es für den Hörer allemal faßlich (Es sei an die "Faßlichkeit einer Struktur" bei Anton Webern erinnert!) dokumentiert ist. Es wäre doch völlig unsinnig gewesen, wenn Frost nur das Ziel gehabt hätte, irgendeinen "fantastischen Klavierklang" herüberzubringen, diesen, also einen ganz bestimmten in jeder Interpretation anzustreben und um seinetwillen die Interpretation kaputtzumachen. Und was ist, wenn eine Abhörequipment dynamisch derart überzeichnet, daß die Gewichtung der Anschlagskultur bei Horowitz zur Farce gerät? Dann ist auch seine Interpretation eine Farce geworden - und was kann er dafür? Das ist ein Problem bei der Besprechung von Tonträgern. (K) Manche Analog-Digital-Diskussion gleicht dem Streit zweier Kaffeetrinker darüber, ob der Zucker nun als Granulat oder Würfel besser sei, aber keiner stellt die Frage nach der individuellen Menge. Die überläßt man einem Zuckerfabrikanten und der sagt: Möglichst viel auf einmal! (P) Persterer, A: CAP Creative Audio Processor - ein Hochleistungssystem zur digitalen Audiosignalverarbeitung, TMT 1988, Tagungsbericht (PL) G. Plenge: Über das Problem der Im-Kopf-Lokalisation, in: Acustica Heft 5/1972 siehe dazu auch: Kürer, R., Plenge, G., und Wilkens, H., 37. AES Convention New York 1969, Preprint 666 (H-3) (Q) Zweifelquotient: 1 (R) Begleittext zur CD Ludwig van Beethoven, Symphonie
Nr.5 c-moll op. 67, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung
(S) Testspiegel (1/1996) über Grado HP 2 Signature in der Zeitschrift STEREO: "Das Maß aller Dinge". Grado hat inzwischen den HP 2 durch ein Nachfolgemodell abgelöst, das gewiß nicht mehr das Maß aller Dinge ist. Also Vorsicht! (SATire) Der allanaloge Weltkongreß muß neben dem alldigitalen Weltkongreß unter dem fürsorglichen Dach des technologisch völlig unfähigen musikwissenschaftlichen Weltkongresses installiert werden, aber bitte so, daß die digital-analogen Grenzgänger beide besuchen können, so wie ein Christ einen evangelischen und einen katholischen Kongreß besuchen kann (und darf). Die Allanalogen unterscheiden sich meist dadurch wesentlich von den Alldigitalen, daß sie sich mit dem hinreichend bekannten Bruderkuß begrüßen, während man die Alldigitalen daran erkennen kann, daß sie beim Hören entweder stehen und die untere Kopfhälfte zur Musik hin ausrichten (Kinntyp) oder sitzen und sich mit nach vorne geneigtem Schädel (Fontanellentyp) ungemein konzentriert dem musikalischen Geschehen widmen. Falls sie weiches Schuhwerk tragen, kann man gelegentlich auch beobachten, daß sie mit der rechten großen Zehe den Takt mitschlagen, wie schlecht erzogene Kammermusiker. Für einen historisch in der Wolle gefärbten
Musikwissenschaftler ist die Diskussion musiktechnologischer Fragen, insbesondere
musikelektronischer Herkunft völlig unzumutbar, es wird ihm eine regelrechte
Perversion des Denkens abverlangt, zumal die Musikelektronik sich durch
die realiter absente Körperlichkeit der das Betrachtungsobjekt, also
die Musik ursächlich bewegenden Elemente, nämlich des Wechselstroms
und des Gleichstroms, jeglicher Deskriptionsversuche entziehen kann und
sich das Objekt daher für die "Vergleichenden" schon gar nicht eignet.
Allein der Sachverhalt, daß der Betrachtungsgegenstand als solcher
kategorisch einen Teil der Musikwissenschaftler ausschließt, regelrecht
imperativ zur Untätigkeit verurteilt, ist schon deshalb von Übel,
weil die Materie a priori gegen die etablierte wissenschaftliche Demokratie
verstößt. Die Musikwissenschaft hat sich das Yoneda-Lemma (siehe
dazu: Schubert, Kategorien I, Heidelberg 197O, Seite 23) insofern angeeignet,
als ein Gegenstand für alle Zweige des Fachs zur Betrachtung opportun
sein muß. Ansonsten ist er unvollkommen und es muß gewartet
werden, bis er entweder durch Selbstmutation oder deren exaktwissenschaftliche
Andichtung jenen Grad der Vollkommenheit erreicht hat, der ihn für
die Analyse geeignet, ja gewissermaßen sogar befähigt erscheinen
läßt.
Man muß also tunlichst beachten, daß die wohl individuell, aber nicht notariell festgelegte Zumutbarkeitsgrenze der Wissenschaftler durch das Forschungsobjekt an sich nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Zum Beispiel kann die Analyse eventueller Kurzschlußgeräusche nicht ohne weiteres mit der Analyse der Aussprache von ss, s, ss, tz, zz, zt, p, pt in Schallaufzeichnungen verglichen werden. "sssstztzssssstzsysxprt" kann grundsätzlich verschieden analysiert werden, abhängig vom Wissenschaftszweig, Standpunkt, Analysemethode und Alter der Analysegeräte. (Da Universitäten eine finanzielle Abschreibung nicht kennen, kommen nach der Entfernung der institutseigenen Staub- und Moderschicht auch zuweilen mosaische Geräte im Sinne einer maschinellen Demokratie zum Einsatz, "damit diese nicht an ein anderes Institut abgezogen werden".) Gerade aber das digital-analoge Forschungsgebiet würde
durch kultusministerielle Ausweisung als "Immerwährendes Forschungsobjekt"
eine Legion von Musikwissenschaftlern in Arbeit und Brot bringen, bevor
sie staatlicherseits dem Straßenbau oder dem jahreszeitlich organisierten
Landschaftsschutz zugewiesen werden. Es kann auch nicht ausgeschlossen
sein, daß zur endgültigen Klärung von strittigen Sachfragen
bitorientierte Parapsychologen hinzugezogen werden müssen, was aber
bei den Gregorianern, die gegenwärtig Gema-Hoch-Zeit haben, Betrübnis
generieren würde, wenn sich nicht gar ernstzunehmende Konflikte entwickeln.
(TOS) Der Verfasser hat zusammen mit anderen ADAT-Benutzern
die ganz wichtige Erfahrung gemacht, daß TOS-Link-Verbindungen geradezu
chaotische Zustände hervorrufen können. Bei dem Versuch ADAT-Bandspuren
(kann auch bei DAT passieren!) in einen Computer zu portieren kam es zu
dramatischen Artefakten, so daß ein regelrechtes Gewitter aus Knacken
entstand. Nachdem meßtechnisch kein Fehler zu eruieren war, kam jemand
auf die Idee den Lichtleiter umzudrehen und siehe da, zu aller hellem Erstaunen
war das Signal nun völlig einwandfrei, einem Coax-Signal durchaus
nicht nachstehend. Der Verfasser begann nun, einmal an den TOS-Kabelenden
zu manipulieren und kam zu dem Ergebnis, daß das Signal um so besser
ist, je planer und paralleler das Glasfaser abgeschnitten ist. Wer an diesen
Stellen mit der Gartenschere arbeitet, wird dann auch seine blauen Wunder
beim Signaltransport erleben.
(V) Völkner Elektronik, Braunschweig, Best.-Nr.: 032-916-692 (W) Einen Vorteil hat die Sache, man kann mit einem guten Editor aus dem digitalisierten Signal die Kratzer herausmachen oder das Rauschen wegradieren. (Z) Der "Zweifelquotient" ist das Divisionsergebnis einer Aussage in einer HiFizeitschrift im Verhältnis zu einer definierten Anzahl anderer Blätter. Ein Beispiel! Blatt A stimmt in einer Aussage von 7 Testberichten mit zweien überein, differiert aber mit 4 Blättern, dann beträgt der Zweifelquotient 3:7. Der Zähler gibt also die Zahl der in der Aussage gleichliegenden Berichte an. Im Nenner steht die Zahl der untersuchten Berichte. Je näher der Quotient gegen Null strebt, um so isolierter urteilt das Blatt, je näher der Wert gegen 1 strebt, um so näher liegen alle Blätter in der Aussage beisammen - oder, um so mehr haben alle voneinander abgeschrieben - oder, um so mehr Kapital hat die Herstellerfirma in das "Sponsoring" ... gesteckt. Pardon! So kommen schließlich die 0 und die 1 doch noch zu den Analogen. (1.4.96) (ZeM) Dieser Aufsatz erscheint in der HIFIscene/Schweiz
und im Mitteilungsheft der ZeM-Vereine Freiburg/ Bremen (ZeM). Daher bitte
ich die HIFIscene um Nachsicht, wenn ich ausnahmsweise nun in die Niederungen
trivialer Studiopraxis hinabsteige, anstatt in den höchsten highfidelen
Soundetagen herumzuturnen, weil sonst unsere Studios unbezahlbar würden.
Mein Studio hat weit über 100 Steckdosen, die SUN-Leiste nicht mitgerechnet!
Andere kommen mit 5 Steckdosen aus, an der fünften hängt die
Stehlampe.
5/1996
↑Aus verschiedenen Gründen wird die extreme oder konsequente Einseitigkeit,
mit der die Vorführungen von ZeM sich auf das nur Akustische beschränken,
immer wieder kritisiert. Einerseits koppelt ZeM sich damit von dem populären
Trend zu Multimedia ab und vergibt damit vielleicht eine Chance, ein größeres
Publikum für seine Vorführungen zu gewinnen. Vielleicht verweigert
sich ZeM aber hierbei nicht nur einer Mode, sondern wird der menschlichen
Natur nicht gerecht, denn der Mensch ist ja mit seinen vielen Sinnen von
Natur aus multimedial angelegt. Handelt es sich also auch bei dieser strikten
Reduktion aufs Hören um eine "Unmenschlichkeit"? Oder ist es einfach
Bequemlichkeit, Unfähigkeit, eine Beziehung zwischen Visuellem und
Akustischem herzustellen und dem Hörer auf diese Weise den Zugang
zur Elektronischen Musik zu erleichtern?
Das bedeutet aber nichts anderes, als daß gerade durch die Reduktion
auf das Akustische die Fähigkeit zum Hören gesteigert werden
kann, und das ist es doch, was wir erreichen wollen. Jede Hinlenkung auf
ein anderes Medium ist eine Ablenkung vom konzentrierten Hören. Dazu
gehört, will man konsequent sein, auch Livespiel. Denn die Manipulationen
des Spielers an einem Synthesizer rufen eher Assoziationen hervor, die
im klassischen Konzertbetrieb anzusiedeln sind, und eine bestimmte Handbewegung
erklärt nicht die Entstehung und Bewegung eines Klanges im Raum. Genau
so wenig wird durch eine Mausbewegung dem Hörer der Aufbau eines Klanges
deutlich.
Fazit: Was zeitweise als ein gewisser Mangel der Vorführungen von ZeM angesehen werden konnte, stellt sich als der richtige Weg heraus: Konzentration durch Reduktion, Einseitigkeit als Angemessenheit, unimedial und damit im eigentlichen Wortsinn universal, d.h. dem Einen zugewandt.
↑Es handelte sich bei den Schülern um die Halbgruppe einer 9. Gymnasialklasse,
die ich seit Februar '95 bedarfsdeckend und eigenverantwortlich unterrichtete.
Die Gruppe bestand aus fünf Mädchen und sieben Jungen. Die Schüler
verfügten über recht unterschiedliche Musikkenntnisse und -fertigkeiten.
Es sind teilweise keine Notenkenntnisse vorhanden. Dieses fehlende Wissen
wirkt sich nachteilig auf die Motivation der Schüler aus, sich im
Unterrichtsverlauf an musikpraktischen Aktivitäten zu beteiligen.
Einige Schüler waren der Meinung, sie könnten ja doch keine Musik
selber machen und zogen sich daher lieber hinter theoretischer Auseinandersetzung
und Musik hören zurück. Während drei Jungen eigene Computer
besitzen, haben zwei Mädchen noch nie einen Computer bedient. Die
Vorkenntnisse und Fertigkeiten der übrigen Schüler waren zwischen
diesen beiden Polen anzusiedeln.
Die Situation an der Schule Diese Unterrichtseinheit am Schulzentrum Schaumburger Straße in
Bremen kann als Pilotprojekt bezeichnet werden, da die vorgefundenen Voraussetzungen
unzureichend waren, die anstehenden Erfahrungen aber entsprechende Neuinvestitionen
anregen können und in entsprechende Überlegungen der Schulleitung
eingeflossen sind. Seit Anfang des Jahres 1995 ist ein Apple-Computerraum
mit acht Schülerarbeitsplätzen und einem Lehrerarbeitsplatz mit
LC-Display und Overheadprojektor ausgestattet. Die beiden letzten Computer
sind ältere Modelle (Apple Classic II) und nicht für die Musiksoftware
der UE geeignet. Der Raum wurde bislang noch nicht für das Unterrichtsfach
Musik genutzt, so daß sowohl Musik-Software als auch die periphere
Hardware fehlten. Freundlicherweise wurde auf meine Anfrage hin die Software
wie auch MIDI-Interfaces von den Vertreiberfirmen für einen begrenzten
Zeitraum kostenlos zur Verfügung gestellt. Der benötigte Sampler
wurde von mir gestellt und die Verstärkeranlage ist Eigentum der Schule.
Vorüberlegungen Der Gegenstand dieser Unterrichtseinheit (UE) ist der Einsatz des Computers
im heutigen Musikleben. Neben der den Schülern vertrauten Popmusik
wird mit diesem Medium auch im Bereich experimenteller Musik gearbeitet.
Im Unterrichtsvorhaben sollen Fragen diskutiert werden, etwa wie: "Hat
die experimentelle Computermusik ihre eigenen Kompositionsregeln?", oder:
"Was hat das Gehörte noch mit Musik zu tun?". Insbesondere wenn Geräusche
als Klangmaterial eingesetzt werden, neigen Laien zu der Position, dies
sei doch keine Musik. Doch anhand einiger musikspezifischer Parameter wie
Rhythmus, Ton- bzw. Klanghöhe, Transparenz und Dichte kann einer solchen
Ansicht begegnet werden.
Didaktisch-methodische Überlegungen Viele Schüler wissen bereits, daß zur Produktion von Popmusik
sehr häufig der Computer eingesetzt wird. Vereinzelt arbeiten sie
bereits selber mit diesen Mitteln und tauschen im Freundeskreis Programme
und Ideen aus. Von den zahlreichen Möglichkeiten soll die Arbeit mit
dem Sequenzer exemplarisch praktiziert werden, zumal diese Anwendung auch
die häufigste ist. Die Veröffentlichungen in der musikpädagogischen
Fachpresse beschreiben meist Unterrichtsversuche mit Ausrichtung auf die
Popularmusik. Achim GIESELER beschreibt in MuB 6/89 den "Einsatz von Sequenzerprogrammen
in der Rock- und Popmusik", Heiner BLECKMANN und Niels KNOLLE(1) berichten
in der gleichen Ausgabe über den Produktionsprozeß eines Blüs
auf dem Computer. Die neuen Arbeitsmittel werden durch die praktische Schülertätigkeit
ausprobiert und ein Bereich des Leistungsspektrums erfahren. Die Musik
selber erfordert weniger Konzentration und Aufmerksamkeit, da sie zuvor
bereits mit herkömmlichen Mitteln (Instrumente, Gesang, Tonbandgerät)
erarbeitet wurde. Die handlungsorientierte Verfahrensweise der o.g. Ansätze
erscheint mir für diesen Unterrichtsgegenstand dringend geboten. Allerdings
halte ich die Fokussierung auf die populäre Musik dem Medium gegenüber
für nicht angemessen. Da der Computer bei Jugendlichen ohnehin ein
gewisses, manchmal auch spielerisches Interesse weckt und dementsprechend
Motivation und Konzentration zunehmen, ist hier meiner Meinung nach ein
idealer Raum, um mit einer neuen Technologie auch neue Wege in der Musik
zu gehen. Es war daher geplant, mit Geräuschen, die per Sequenzerprogramm
im Sampler angesteuert werden, eine Schülerkomposition zu erarbeiten.
Dabei gibt die Länge eines Events an, wie lange dieses Geräusch
erklingt, ob es kurz angespielt wird, sich in seiner ganzen Länge
entfalten kann oder gar darüber hinaus verlängert, d.h. teilweise
wiederholt wird (Loopbildung). Die erklingende Höhe eines Geräusches
ist davon abhängig, welche "Note" dem Original zugeordnet wird und
in welcher Relation das ausgelöste Event dazu steht. Wird beispielsweise
das Original dem c3 zugeordnet, erklingt ein c4-Event mit doppelter Frequenz,
entsprechend dem Frequenzverhältnis einer Oktave. Die Transponierung
wird innerhalb des Samplers vorgenommen. (2) Durch das Zusammenwirken unterschiedlicher
Klänge und deren einzelnen Veränderungen ergibt sich eine Musik,
deren wesentliches Merkmal die jeweilig wahrnehmbare Klangfarbe ist. Die
Schüler erarbeiten somit eine Klangfarbenkomposition. Im Schülerduden
"Die Musik" ist hierzu folgende Definition zu lesen:
Warum überhaupt experimentelle Musik? In der experimentellen Musik werden die Möglichkeiten des Computers
in hohem Masse genutzt, insbesondere werden Arbeitsverfahren entwickelt,
die in dieser Form mit keinem anderen Werkzeug realisierbar sind. Daher
eignet sich diese Musik sehr gut, um die Computerarbeit kennenzulernen.
Auswertung der Unterrichtseinheit Bereits in der ersten Unterrichtsstunde hatte ich den Schülern
bei der Vorstellung meiner Planung eingestanden, daß ich durchaus
unsicher sei, ob oder wie wir die vorgegebenen Ziele erreichen würden,
da wir teilweise Neuland beträten. Zu meiner eigenen Freude haben
sich die Schüler im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei diesem Vorhaben
engagiert, so daß sich das Erreichte durchaus sehen und hören
lassen kann.
(1) H. BLECKMANN/N. KNOLLE, in Musik und Bildung, Heft 6, 1989, S. 334-336
↑
Rettbehr MeierElektronische Klanginstallationen am 30./31. März1996 in der Elzhalle Emmendingen-Wasser - ein subjektiver Bericht
Zum Beginn der Veranstaltung am Samstag um 14 Uhr führte K. Weinhold
die Zuhörer mit seinen Soundprozessen und Erläuterungen des kulturgeschichlichen
Hintergrundes in die elektronische Klangwelt ein. Die Prozesse waren sowohl
moderate, computerunterstützte Interpretationen von klassischen Werken
wie Schumanns "Träumerei", aber auch oktophone Raumklang-Soundschichtungs-Verfremdungen
und extreme Time-Stretchings von OA (dokumentarische Originalaufnahmen
vom Emmendinger Musikfest '95), sowie überraschend frisch klingende
Collagen aus älterem, analogem Synthese-Material der frühen 80er
Jahre. Apropos Raumklang: Bei vielen ursprünglich rein stereophonen
Aufnahmen, wurde ein erweiterter Raumklang mittels Surround-Decoding auf
sechs Lautsprecher erreicht. Dies bot während der zwei Tage z.T. überraschende,
zufällige Raumortungen, denn die Aufnahmen waren ja nicht entsprechend
codiert.
Am Sonntag bot G. Schneider - nach einleitenden Worten und weiteren,
teils analogen Soundprozessen von K. Weinhold - quadrophone Produktionen
mit zwei Yamaha TX81Z. Es wurde eindrucksvoll gezeigt, daß auch mit
nur vier FM-Operatoren höchst interessante Strukturen möglich
sind. Die Ansteuerung der Module geschah im Studio mittels selbstgeschriebener
Software in GFA-Basic auf dem Atari, wodurch sämtliche Sys-Ex-Parameter
zur Verfügung standen. Dies wurde besonders schön in der Produktion
"Coarse and Fine" dargestellt, wobei die Modulator- und Träger-Frequenzen
mit sehr hoher Auflösung verändert wurden, was so mittels "normalem"
Midi nicht möglich gewesen wäre.
Ich denke, die Veranstaltung können wir damit künstlerisch wie finanziell, sowie organisatorisch, als gelungen und erfolgreich bewerten. Im Namen des Vereins bedanke ich mich bei folgenden Personen: H. Arnolds für den Alesis Quadrasynth und Fahrtdienst
↑Röhren, Vintage, Tweed-Verstärker. Was bis vor ein, zwei Jahren nur in den Musikabteilungen für die Strom-Gitarristen zu beobachten war, erreicht nun auch die bis dato volldigitale Welt der Tastatöre. Man hat offenbar die Lust am "Schrauben" wieder entdeckt, und überall schießen analoge Synthesizer, auch in Form von Modularsystemen - was sonst - , wie die Pilze aus dem Boden. Im Internet gibt es die Enthusiasten, die auf ihrer eigenen Homepage ihr eigenes Selbstbau-System nebst Bauplänen mit viel Aufwand stolz der restlichen Menschheit präsentieren. Man gebe einer Suchmaschine wie "alta vista" einmal Suchbegriffe wie VCO, LFO usw. vor und man wird sehen. Das paßt gut zum Retro-Zeitgeist dieser Tage. 70er T-Shirts, James-Brown-Samples, Plattformschuhe, "ich find Schlager toll!!", da fühlt sich der Moog oder ARP so richtig wohl. Nein, im Ernst, es ist wohl mehr als eine Modeerscheinung. Nachdem die Midi-und DSP-Euphorie etwas abgeklungen ist, hat man die Qualitäten der "altmodischen" Modularsysteme wiederentdeckt und schätzen gelernt (s.a. [1],[4]). Es gibt da sicherlich tief in die Köpfe eingedrungenen Werbe-Pauschal-Unsinn, wie analog = gut und digital = böse, was ich schon von Berufs wegen selbstverständlich ablehne. Es kommt eben sehr auf die jeweilige Implementierung an. Die Offenheit der analogen Geräte und der intuitive Echtzeit-Zugang zur Synthese, die man ja per Patchchord tatsächlich BEGREIFEN und verändern kann, diese Vorteile lassen die Nachteile leicht vergessen. Hier sind die digitalen Geräte momentan noch nicht so weit. Und nicht zuletzt ist es der Sound (man höre [2]), der für jedes System einzigartig ist, und durch bloßes Aufzeichnen als totes Sample nicht dargestellt werden kann. Es ist also durchaus zu begrüßen, wenn derartiges wieder neu auf dem Markt erscheint, denn wer ist schon in der glücklichen Lage oder im richtigen Alter, ein original Vintage-System wie Moog 55 oder inzwischen auch Roland 100M zu besitzen? Für die meisten Anwender, gerade auch im Pop-Bereich sind diese neuen Geräte auch vollkommen ausreichend. Die Resonanz im Internet zeigt, daß sie dankbar dafür sind, obwohl zum Teil die technische Ausführung bemängelt wird. Wie ist das aber nun mit der Eignung für E. M.? Daß hier
höhere Ansprüche als bei Pop-Produktionen zu stellen sind, ist
wohl jedem klar. Eine ergonomische Bedienung ist Pflicht. Dazu gehört
vor allem ein durchdachtes und logisches Konzept. Vor allem sollte aber
das Grundprinzip, nämlich die universelle Spannungssteuerung, unter
keinen Umständen verletzt werden, denn dies ist gerade für die
Ausdrucksmöglichkeiten der E. M. von entscheidender Bedeutung. Jeder
Parameter im System sollte, wenn es nur irgendwie machbar ist, spannungssteuerbar
sein, jedes Modul sollte damit jedes andere kontrollieren können.
Zwischen audiofrequenten- und DC-Steuerspannungen sollte kein prinzipieller
Unterschied gemacht werden. Nur dann hat man die totale Modulationsmatrix,
die wirklich ausgefallene Sounds erlaubt.
Um so unverständlicher ist es, daß 1996 bei den neu auf dem
Markt erschienenen Geräten diese Errungenschaften weitgehend fehlen.
Meist ist weder der ADSR noch die Filterresonanz spannungssteuerbar, die
Liste ließe sich fortsetzen. Das ist nicht nur sehr schade, das ist
eindeutig technischer Rückschritt!
Und wie sieht es mit der Ergonomie aus? Zum Teil werden zu kleine, unübersichtliche Frontplatten und schlecht bedienbare Potentiometer, Schalter und Buchsen bemängelt. Das mag Geschmackssache sein. Für manche Systeme wird eine Unzahl von Modultypen angeboten. Aber eigentlich sollte ein Entwickler darauf achten, daß die Module möglichst universell anwendbar sind. Er sollte eher wenige, aber dafür sehr gut durchdachte Modultypen designen. Außerdem sollte er berücksichtigen, welche Module durch Zusammenschaltungen anderer Module vielleicht ersetzbar sind. Er sollte ein logisches, harmonisches Gesamtkonzept haben, man nennt das dann Ingenieurskunst. Der Nutzer hat es in diesem Falle mit der Bedarfsplanung und vor allem der Anwendung viel einfacher und die angesprochene Universalität eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Leider ist das bei den neuen Systemen oft nicht der Fall. Schaltungstechnisch ist es z. B. so, daß bei einem VCA die lineare und die exponentielle Charakteristik mit geringen Kosten sehr leicht in einem Modul angeboten werden können. Das macht durchaus musikalisch Sinn (linear für Modulationen im Audio-Bereich klingt angenehmer, exponentiell eher für Hüllkurven). Tatsächlich fertigt man lieber zwei verschiedene Module, ein lineares, und ein exponentielles. Man verschlechtert so bei gleichzeitiger Nutzung den Signal-Rauschabstand und muß Platz und Geld für zwei Module spendieren. Die aktuellen Modulsysteme gefallen mir also allesamt nicht, ich halte sie speziell für E. M. als ungeeignet. Ich habe aus dieser Bewertung die Konsequenzen gezogen und werde mein eigenes Modulsystem zu Ende bauen, selbst wenn das lange dauern wird. Um keinen falschen Eindruck aufkommen zu lassen: Dieses System wird ein Unikat und ist unverkäuflich! Der Ringmodulator als Spin-Off dieser Entwicklungsarbeit wird jedenfalls schon am ZeM-Wochenende im September '96 zu hören sein. Die Medaille hat natürlich immer zwei Seiten. Der Untergang der
Firmen Moog, ARP, Kurzweil, Dr. Böhm usw. hat gezeigt, daß Qualität
und Genialität allein nicht für das Überleben einer Firma
ausreichen. Man kann im Gegenteil sogar beobachten, daß sich tendenziell
immer das schlechteste, idiotischste System auf dem Markt durchsetzt, da
es meist mit der wirtschaftlich optimalen Lösung zusammenfällt
(z.B. der IBM-kompatible PC, VHS-Video, vielleicht auch Midi?). Großer Einsatz
lohnt sich nicht, der Kunde dankt es einem offenbar in diesen hochkompetitiven
Märkten nicht. Mit diesen frustrierenden Einsichten einerseits und
der Verantwortung für eine Firma andererseits würde ich es genauso
machen: schnell den Hype ausnutzen, irgendein Gerät herausbringen
und den Markt abschöpfen, denn wer weiß schon ob es sich morgen
noch verkauft?
[1] T. Reyber, Die Synthesizerausstellung
..., ZeM MT 16, Januar 1995, S5.ff.
↑ZeM im Internet Parallel zum Erscheinen dieses Heftes hat nun auch ZeM Freiburg (ZeM
Bremen wird folgen) eine Internetseite mit der Adresse: "http://www.ZeM.de".
Mitgliedertreffen bis auf weiteres ausgesetzt Bis Ende dieses Jahres wird es in Freiburg keine regelmäßigen
Mitgliedertreffen geben. Diese fanden bis dato seit 1989 jeden letzten
Mittwoch im Monat statt.
↑
Rückseite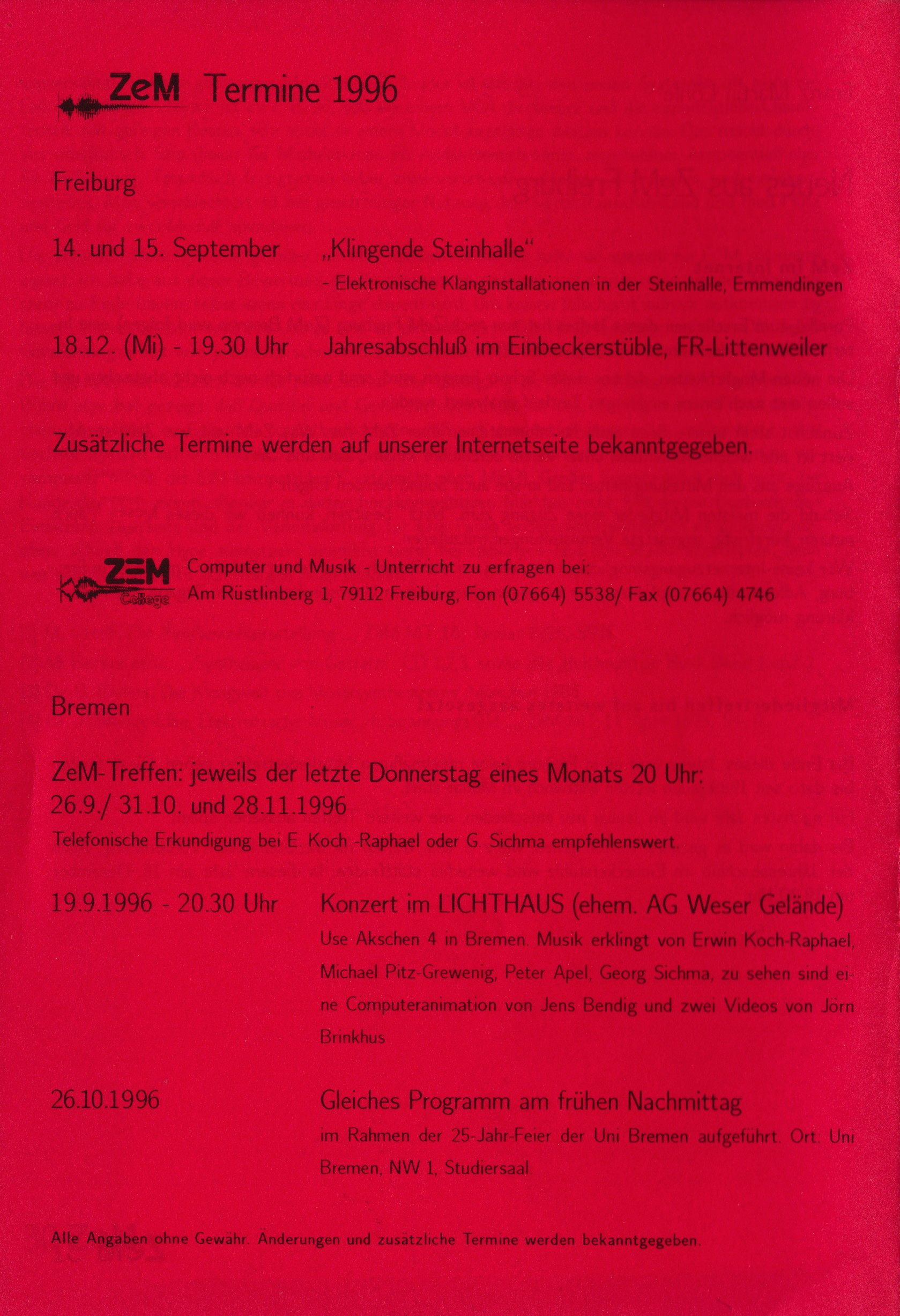
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© ZeM e.V. | ZeM Heft Nr. 20 - Herbst 1996
|