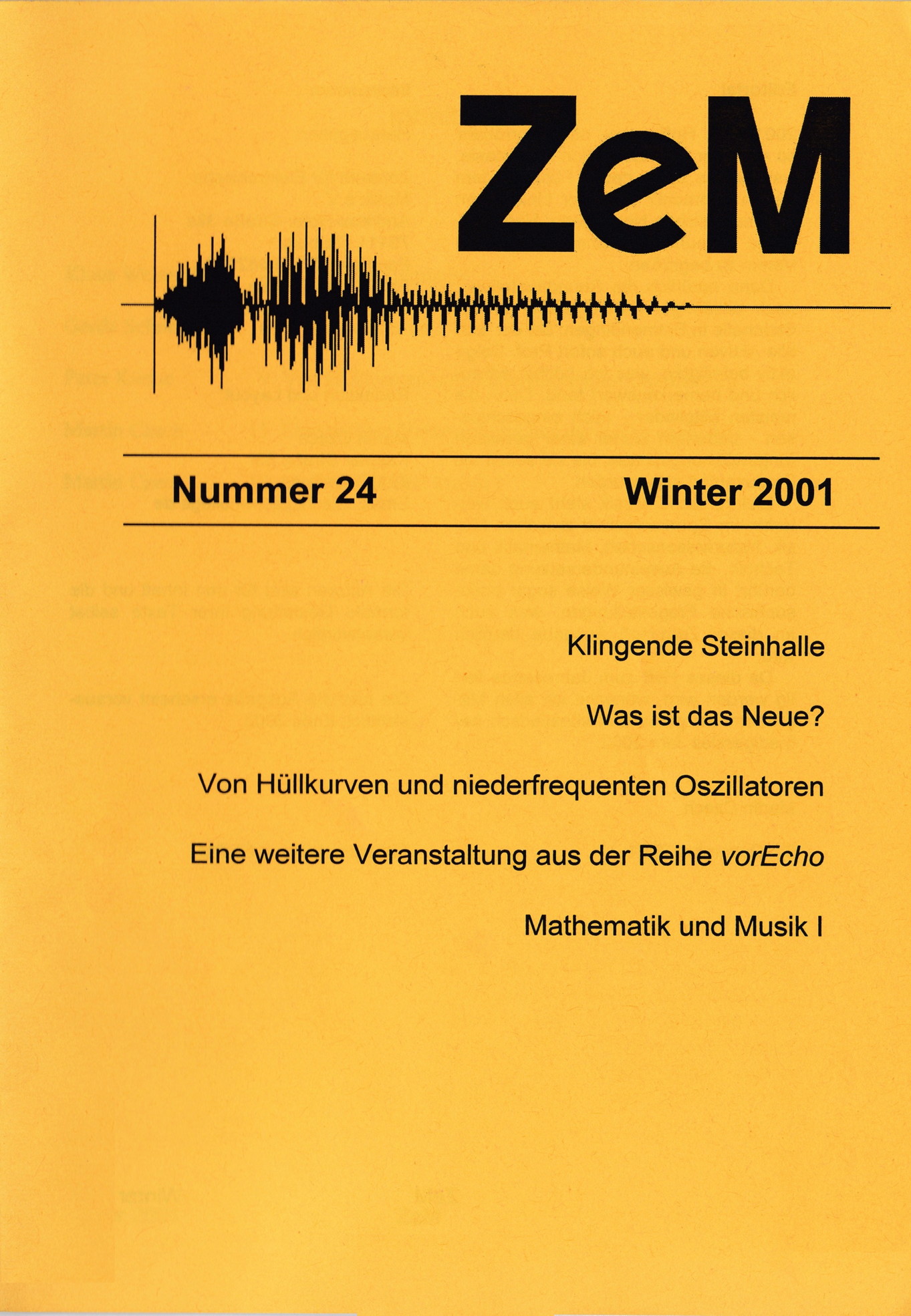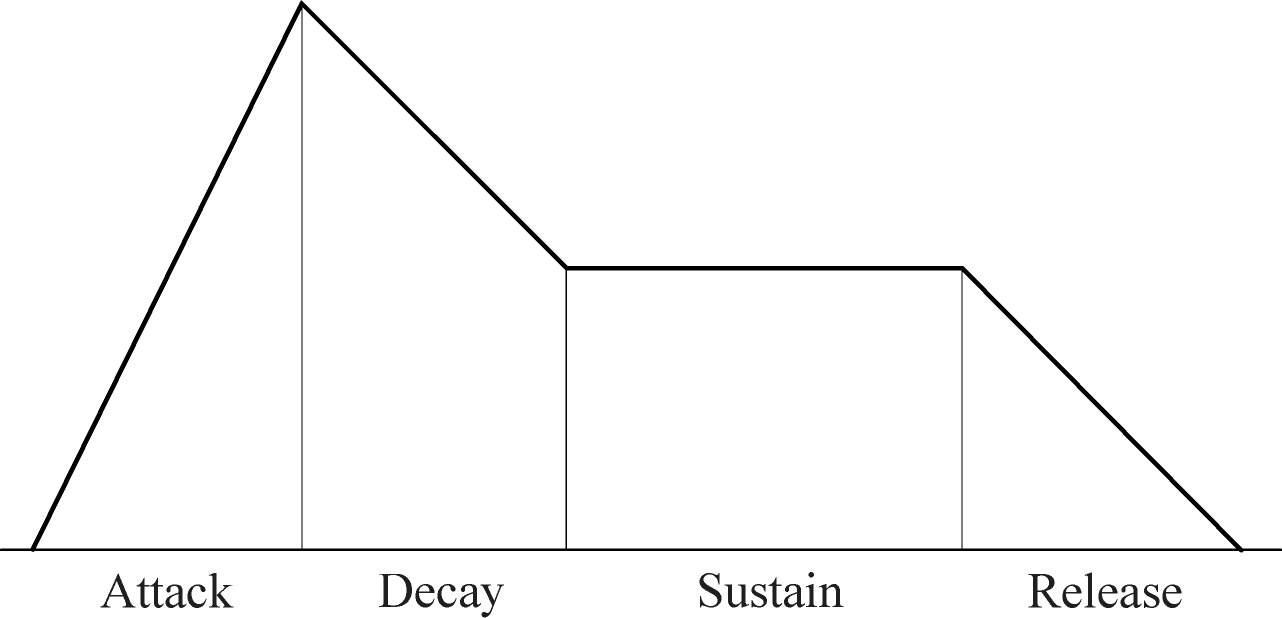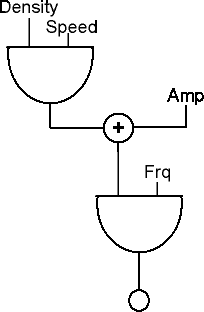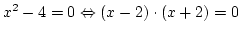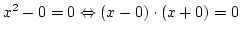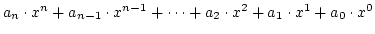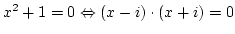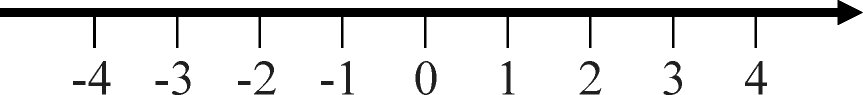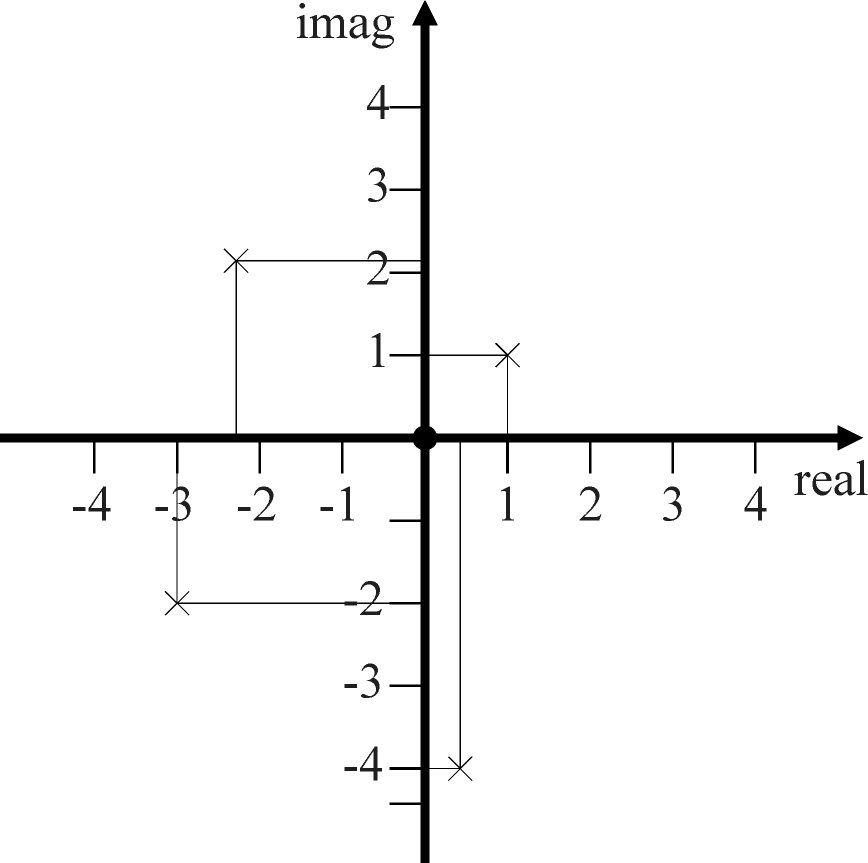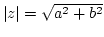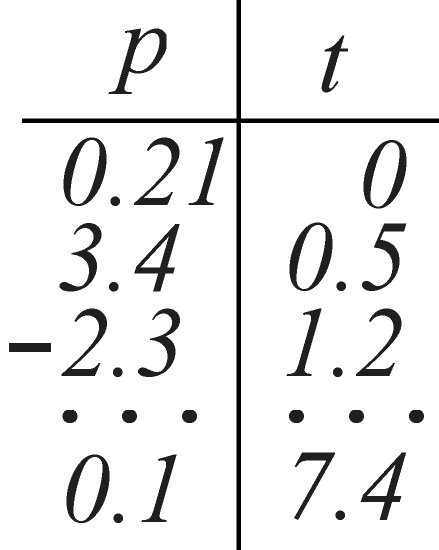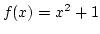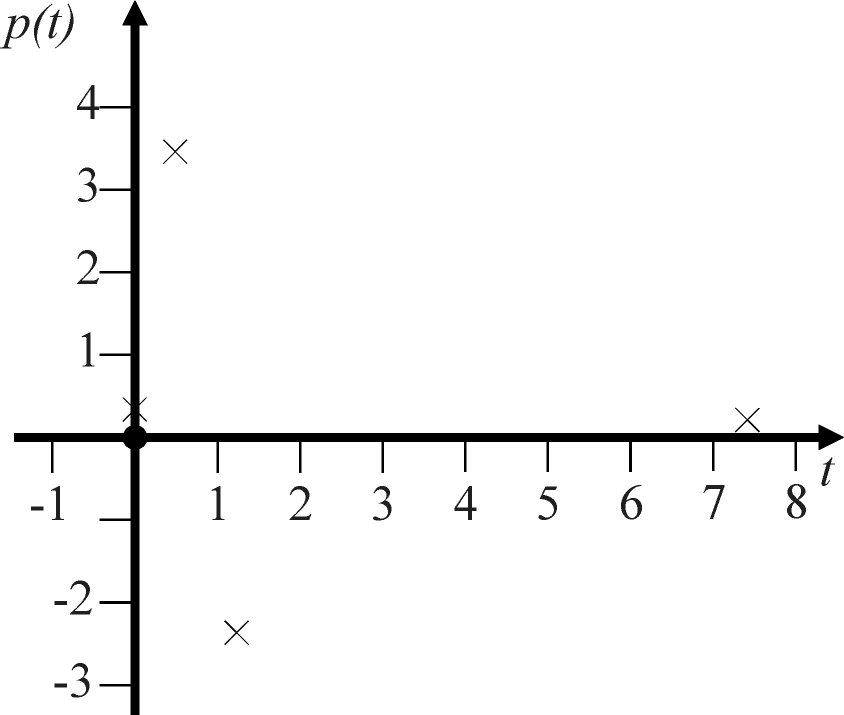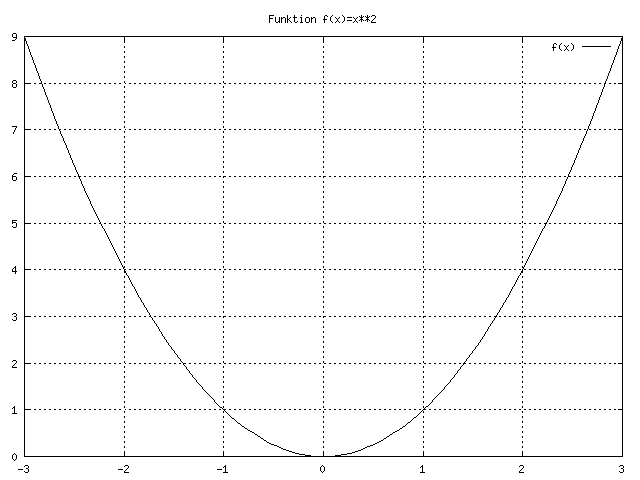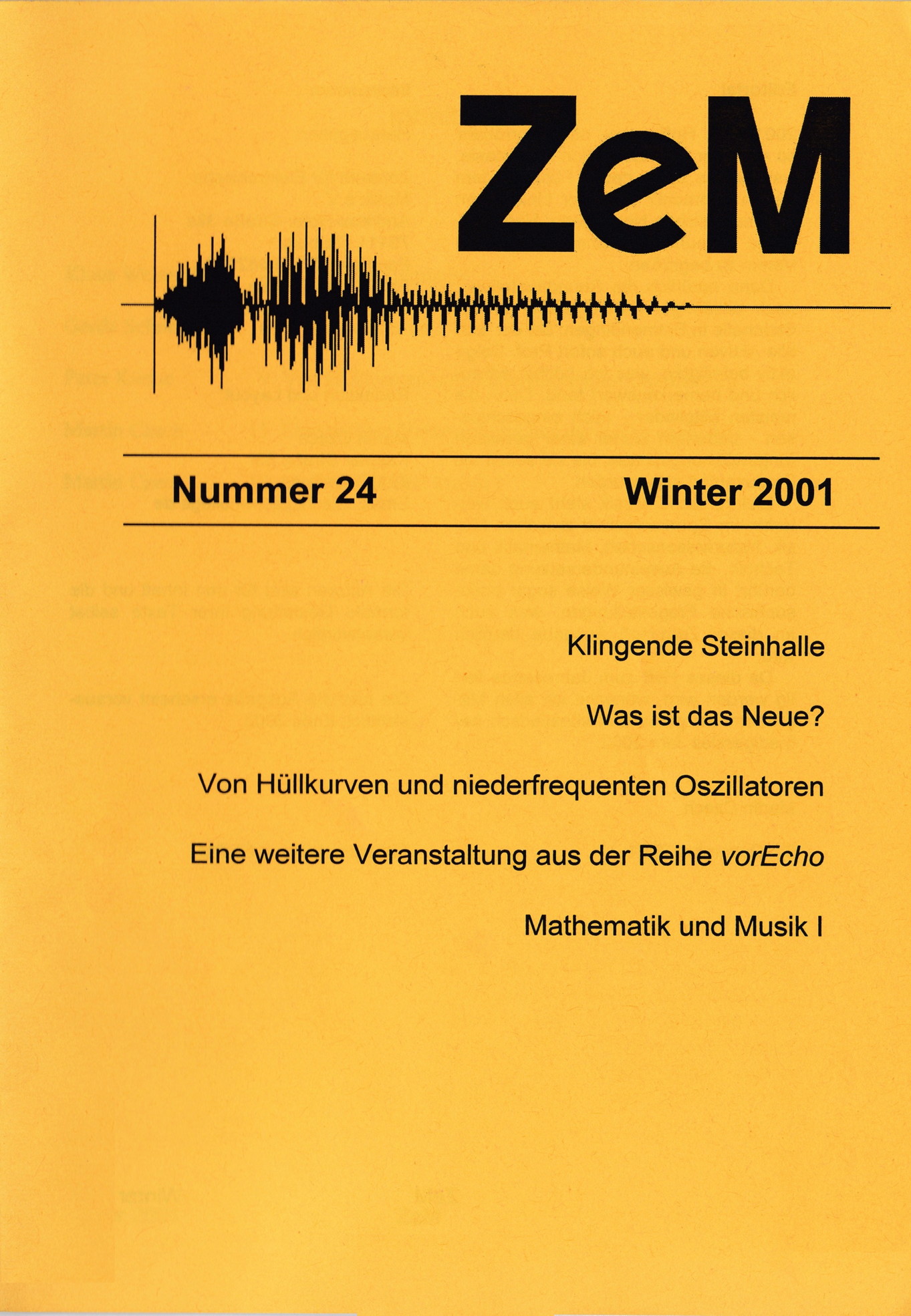
ZeM Mitteilungsheft Nr.
Redaktion: Rettbehr Meier
Editorial
2001, das Hoffnungs- oder Horrorjahr so mancher Science-Fiction
Phanstasie, was hat es unter neuer Führung dem Verein gebracht? In
erster Linie einen sehr erfreulichen Neuzugang: Herr Prof. Dolge ist
nun noch einmal offiziell im Verein zu begrüßen.
Dann natürlich die Soundaustellung, nach einjähriger
Pause wieder in der Steinhalle in Emmendingen, bei der sich alle
aktiv beteiligten, was ich
höchst erfreulich und bemerkenswert fand. Denn die meisten
Mitglieder - mich eingeschlossen - bedurften bisher einer gewissen
Eingewöhnungsphase, bis sie selbst als Produzenten aktiv wurden.
Elektronische Musik steht auch weiterhin im Spannungsfeld
zwischen Musik, Naturwissenschaft, Mathematik und Technik, die
Auseinandersetzung damit berührt in gewisser Weise sogar
philosophische Fragestellungen, was auch an dieser ZeM-Heft Ausgabe
deutlich wird.
Da dieses Heft zum Jahresende fertig werden wird, wünsche
ich allen Mitgliedern ein gutes und künstlerisch befriedigendes
Jahr 2002.
Rettbehr Meier
↑
Klaus Weinhold
Klingende Steinhalle
Seit ca. 20 Jahren haben wir, besser: hat man die Möglichkeit, besser: die
Möglichkeiten, elektronische, besser: elektroakustische Musik, besser: Sounds
herzustellen, besser: sie zu produzieren, schlechter: zu komponieren. Schon bis
hier eine Menge neuer sprachlicher Ausdrücke, die eigentlich einer genauen
Definition, also einer erforderlichen Eingrenzung harren. So ist wohl die
Bestimmung "elektroakustisch" gar nicht so unzutreffend, denn das Wort
elektro- elektronisch ist zu weitläufig. Wir wollen und müssen den Bezug zum
Hören herstellen und das dazugehörige Wort ist griechisch akouein = hören.
Lassen wir die anderen Worte auf sich beruhen, dass aber Musik durch Klang
und Komposition durch Produktion ersetzt werden, wird hier behauptet, zunächst
ohne Begründungen und Beweise zu liefern.
Eine kurze Gegenüberstellung: elektronische (gleich elektroakustische)
Klänge sind möglich, potentiell, klassische Musik ist tatsächlich, real.
Elektronische Musik ist stets neu zu erzeugen und zugleich erzeugbar, klassische
Musik ist als schon immer gegeben erstarrt. Elektronische Musik ist flüssig wie
Wasser und Wolken, sich stets verändernd, flüchtig, kurz: sie ist frei und offen.
Klassische Musik ist gebunden, Gefolgschaft fordernd, die Freiheit
einschränkende Bedingungen stellend u. v. m.
Man hört und sieht schon (man sieht keine Musiker): Offenbar besteht ein
grundlegender Unterschied zwischen dem elektronischen Sound und der
klassischen Musik der Töne. Tatsächlich, damit ist alles gesagt in
vordergründiger, kurzer Theorie und einfach ausgedrückt. Hier ist offensichtlich
ein Bruch passiert, so wie es viele dieser Symmetriebrüche in dieser Welt gibt:
so z. B. die Spaltung anorganisch - organisch. Dieser Bruch vom Organischen:
"Musik aus dem Bauch", "Musik, die zu Herzen geht" zum Anorganischen:
"technisch, tot, maschinell, intellektuell" muss gehört und gesehen
("Lautsprecher") werden, um Zugang zu finden zu diesem anorganischen und
sicher inhumanen Sound.
Wir haben in den letzten 20 Jahren solche unorganischen Klänge "vorgeführt",
daraus entstand der so unbefriedigende Ausdruck "Vorführung". Dennoch:
Vielleicht war das Wort gar nicht so abwegig, wir führten "vor" und nicht
"nach", wir spielten nicht "nach", sondern "vor", wir gingen nach vorn in eine
Zukunft, die damals, quasi aus dem Nichts entstand, mit Synthies, Recordern und
Keyboardboxen hin zu dem, was heute nach 20 Jahren im Mittelpunkt der
Soundelektronik steht.
Mag sein, dass wir damit ein vorläufiges Ende erreicht haben, zumindestens so
lange noch Klang über technische Medien als Ausgabe und Ohren als Empfänger
in Geltung sind.
Noch einige Reflexionen zu den Begriffspaaren Komposition - Produktion
oder Plan - Ablauf oder wieder: Mögliches - Gemachtes oder Vorgegebenes -
Gefestigtes. Ein Reinhören in die "Klingende Steinhalle" dieses Jahres gibt
Aufschlüsse und Erkenntnisse. Jeweils zu Beginn der drei Veranstaltungen
erklang eine echte, sich produzierende, umfassende Soundvorführung:
Cassettenrecorder, ein Mischpult wurden unregelmäßig mit den Reglern bedient,
die freie Regel ergab lediglich eine statistische Verteilung der Reglerbewegung.
Was die Cassetten an Klangmaterial abgaben, war weitgehend unbekannt:
produzierte Klänge aus 20 Jahren mit verschiedenen Instrumenten und
Programmen. Das Ergebnis war vielleicht positiv und negativ verblüffend, es
war aber eines: unvorherhörbar und nicht mehr reproduzierbar. Sicher: Die
Abläufe hätten auf einem modernen HD-Rekorder gespeichert werden können,
eine Komposition mit motorgesteuerten Fadern, aber das hätte eines zunichte
gemacht: die totale Freiheit und Freizügigkeit der Abläufe. Hätte jemand eine
"Aufnahme" machen wollen, hätte man zurufen müssen: "Bitte nicht, das ist zum
einmaligen Hören und Vergessen gemacht". Eine kontingente, zufällige Musik
und sagen wir ruhig: Musik.
Im Vorraum der Steinhalle erklang eine andere Produktion:
Softwareprogramme hatten unter gegebenen Randbedingungen Klänge erzeugt,
manche gleich oder ähnlich, leise, meditativ zum Mithören einladend. Diese
Abläufe waren nun reproduzierbar gemacht worden, die Freiheit der
kontingenten Produktion war hier festgestellt worden, sie sollte nicht vergessen
werden, sie sollte Geschichte werden und darum auch einmalig sein.
Die neuen Produktionen können aber auch - und das nicht zu knapp -
Anleihen nehmen an klassischen Vorbildern: der fixierten, einmalig in jeder Zeit
reproduzierbaren Komposition, Stücke, mit Namen versehen, auf etwas
hinweisend, also eine Referenz habend, zeitlich begrenzt. Diese Stücke machen
das Hören einfacher, befreit von der lähmenden Ungewissheit, nicht zu wissen,
wo man ist und was das ist.
Die "Klingende Steinhalle" wird für die Elektronische Musik selbst zum
Symbol. Die Halle ist eigentlich Angebot: mit Menschen gefüllt zu sein, die
ausgerichtet auf Redner oder Musiker hingewandt sind, fixiert und geführt mit
bedeutenden und aussagekräftigen Medien. Bei uns erklang die Halle mit
bedeutenden neuen, bedeutungslosen Klängen, die nicht als musikalische
Medien auf anderes hinweisen, etwa auf die "höhere, bessere Welt" oder die
Menschen zum gemeinsamen Gebet vereinen, hin zu der Apsis, die auch auf
gottesdienstliche Verwendung der Halle hinweist.
Die Halle erklang bei uns in sich als Raum gewordener Klang. Sie erklang, wie
wenn sie sagen wollte: "Sono, ergo sum". Es erklingt, also erklingt es. So haben
wir vielleicht ohne es zu wollen und zu ahnen einen solchen Quantensprung und
auch eine Traditionsverletzung in der "Klingenden Steinhalle" vollzogen. Das
will viel heißen: Der Weg von Musik zum Sound, aber auch der Weg vom "ich
bin, ich spiele" zu "es spielt" und "es ist". Die "Klingende Steinhalle" klingt,
hoffen wir, noch mehrere Jahre.
↑
Gerda Schneider
Was ist das Neue?
Was ist das Neue? Diese Frage wurde vor kurzer Zeit auf einer
Zusammenkunft von Pädagogen gestellt, die sich mit den Neuen
Medien etwas intensiver beschäftigen, bezogen auf das Neue an den
Neuen Medien. Wir erhielten eine durch wissenschaftliche Literatur
gestützte Antwort: Das Neue an den Neuen Medien ist die
integrative Verknüpfung der Medien auf digitaler Basis.
Das Funktionieren beruht auf der Navigation und der
Rückmeldung (Interaktion). Durch die Neuen Medien, das haben wir
alle inzwischen nicht nur gelesen oder gehört, sondern auch selbst
erfahren, ändert sich der Umgang mit Wissen, der Erwerb von
Informationen, die Art des Lernens, die Arbeitsmethoden und v.a. das
Internet, der Inbegriff für Neue Medien, verändert unser
Denken und auch unsere Verhaltensweise. Dies wird besonders am
Leseverhalten deutlich, wie in folgendem Text von Ernst Fischer,
Professor am Institut für Buchwissenschaft an der
Johann-Gutenberg-Universität Mainz und Mitglied des
Encarta-Beratergremiums, beschrieben: Elektronische
Netzwerke sind
außerdem ein flüchtiges Medium: "Der User kann sicher sein,
immer überwältigend viel an Information anzutreffen, aber
niemals kann er sicher sein, die Informationsangebote unverändert
wieder so anzutreffen, wie er sie schon einmal gesehen hat. Dieser
Flüchtigkeit und der bloßen Virtualität der
Kommunikationswelten ist der Mensch aufgrund seiner in
prähistorischer Zeit erworbenen Grundausstattung nicht ohne
weiteres gewachsen, er muß sich des Dauernden vergewissern, um
sein Bewußtseinskontinuum von außen her zu stabilisieren.
Die "Antiquiertheit des Menschen" (Günther Anders) angesichts des
technologischen Fortschritts wird einmal mehr offenbar. ... Schon sind
aber Anpassungsleistungen zu beobachten, durch die sich die geistigen
Prozesse selbst verändern. Hypertexte erfordern ein anderes
Leseverhalten als der lineare Text des Buches, bei dem es Anfang und
Ende und für den Leser jederzeit Gewißheit darüber
gibt, an welchem Punkt des Mitteilungskontinuums er sich befindet. Wenn
es zutrifft, daß elektronische Netzwerke die Struktur
menschlichen Denkens zutreffender abbilden als das Buch, dann wäre
in dieser strukturellen Affinität zum assoziativen Denken das
Faszinosum des Internet begründet, das als ein "externes Gehirn"
betrachtet werden kann. Netzkommunikation tritt uns ähnlich wie
Lesen bereits als eine eigene Kulturtechnik entgegen. Das Flanieren in
Cybercity fördert ein geistiges Nomadentum, erweitert unser
Realitätsverständnis um eine neue mediale Dimension, - der
Mensch bleibt aber auch hier das Maß aller Dinge".
Wir von ZeM haben uns nun nicht Multimedia verschrieben,
wollen den Sound pur, hören und sonst nichts - aber: trifft nicht
das Grundsätzliche des oben festgestellten Sachverhalts auf die
Elektronische Musik zu? Kann man hier vielleicht von einem Fraktal
sprechen? Und was ist dann damit genau gemeint?
Nehmen wir den einführenden Text "Elektronischer Klang"
zu unserer Veranstaltung "Klingende Steinhalle" vom September 2001: Dem
linearen Vorgehen beim Lesen eines Buches entspricht die Komposition,
die Anfang und Ende hat, deren Ablauf in jedem Teil zeitlich genau
festgelegt ist. So wie jedes Kapitel in einem Buch seinen Platz im
Kosmos des Buches hat, bilden die Teile einer Komposition ein
organisiertes Ganzes. Ein Musikstück aber, dessen Ablauf der
Zufall regiert, ein Prozess, nicht komponiert, ermöglicht ein
"Flanieren", ein "Nomadentum" in der Welt des Sounds. Solche
Klänge, solche Musik führt zu unerwarteten Ergebnissen, so
wie auch beim Surfen im Netz, ein solches Stück ist offen, und so
wie der Weg beim Surfen immer wieder anders verlaufen kann, es sei
denn, ich wähle bewusst den gleichen Weg, so klingt auch diese
Musik immer wieder anders, werden die Produktionen jedesmal anders
ablaufen, können abgebrochen werden, wie das Surfen im Netz,
können auf Irrwege führen - aber man kann auch da an
irgendeiner Stelle wieder einsteigen, und dann wird nicht einfach von
derselben Stelle aus genau gleich wieder weiter gemacht, sondern von
diesem Punkt aus kann der Ablauf ein anderer sein.
Auch wenn das "Material" auf einem Datenträger
festgehalten worden ist, jede Vorführung ist neu und
vergänglich. Genauso wird es sie nicht mehr geben. Wenn es im
Originaltext heißt: "Der User
kann sicher sein, immer wieder
überwältigend viel an Informationen anzutreffen, aber niemals
sicher sein, die Angebote unverändert wieder so anzutreffen, wie
er sie schon einmal gesehen hat", so trifft das auf unsere
Vorführungen zu, wir müssen nur den "User" durch den
"Hörer" ersetzen.
Diese unbegrenzten Möglichkeiten, diese Offenheit
können
faszinierend sein, d.h. sie verzaubern uns oder etwas negativer sie
verhexen uns, m. a.W.: sie ziehen uns in ihren Bann. Warum das so ist,
wird ebenfalls an einer anderen Stelle gesagt: "Dieser Flüchtigkeit
und der bloßen Virtualität der Kommunikationswelten ist der
Mensch aufgrund seiner in prähistorischer Zeit erworbenen
Grundausstattung nicht ohne weiteres gewachsen, er muß sich des
Dauernden vergewissern, um sein Bewußtseinskontinuum von
außen her zu stabilisieren. Die "Antiquiertheit des Menschen"
(Günther Anders) angesichts des technologischen Fortschritts wird
einmal mehr offenbar". Es ist also die Entsprechung zu unserer
Gehirnstruktur. Dieser Befund ist sehr interessant, zeigt er doch auf
ganz andere Weise das Menschliche der Elektronischen Musik, die diese
Prinzipien realisiert.
Doch wird auch auf ein Phänomen hingewiesen, das wir nur
bestätigen können: Freiheit zieht uns nicht nur in ihren
Bann, indem sie bei uns angenehme Gefühle, Freude - man denkt hier
an "Freude schöner Götterfunke" -auslöst, sie bewirkt
auch Angst. Dies hängt, wie auch in diesem Artikel dargelegt,
damit zusammen, dass der Mensch, als er sich zum homo sapiens
entwickelte, Orientierung und Sicherheit benötigte, um
überleben zu können. Uns geht es aber in diesem Bereich nicht
ums Überleben, wir können in der Welt der elektronischen
Klänge die Freiheit nutzen und die "Antiquiertheit des Menschen"
wenigstens versuchen zu überwinden.
Quellen:
"Buch und Internet - Perspektiven einer neuen
Medienkonkurrenz," Microsoft(r) Encarta Enzyklopädie 2000. (c)
1993-1999 Microsoft Corporation.
↑
Peter Kiethe
Von Hüllkurven und
niederfrequenten Oszillatoren
In der ersten Folge dieser Csound Reihe [ZeM Heft 23] wurde die Installation
beschrieben und ein Programm vorgestellt, mit dem auf einfache Art und
Weise Csound bedient werden kann. Den Abschluss bildete das erste
Projekt - die Erzeugung eines Sinustons. In diesem Artikel wird der
Einsatz von Hüllkurven und LFOs (Low Frequency Oscillators) und
deren musikalische Wirkung beschrieben. Außerdem gehe ich
näher auf Header, Variablen und P-Felder in Csound ein.
1. Die Hüllkurve
instr
1
a1 oscil 10000, 440, 1
out a1
endin
So sah ein Teil unseres Orc-Files aus dem letzten Artikel aus.
Es bewirkt die Erzeugung eines Klanges mit einer Amplitude von 10000
und einer Frequenz von 440 Hz. Die Tonlänge und Grundwellenform
wird im Sco-File definiert. Wie muß man dieses File
verändern, damit sich die Tonhöhe innerhalb eines Klangs
verändert? Der Ton soll innerhalb einer Sekunde von 440 Hz auf 880
Hz gleiten.
istr
1
kfrq line 440, 1, 880
a1 oscil 10000, kfrq, 1
out a1
endin
Zur Lösung dieses Problems benötigen wir den Befehl
line. line definiert eine Variable, hier kfrq, der das Gleiten von 440
Hz bis 880 Hz innerhalb einer Sekunde zugeordnet wird. Diese Variable
ersetzt in der nächsten Zeile die Konstante 440. Natürlich
kann man die Lautstärke genauso verändern. Bei mechanischen
Instrumenten verändert sich die Lautstärke kontinuierlich.
Spielt ein Instrumentalist einen Flötenton, so hört man
zunächst das Anblasgeräusch. Die Lautstärke nimmt danach
ab, bis ein konstanter Pegel erreicht wird, bei dem der Instrumentalist
den Ton hält. Unterbricht der Instrumentalist den Ton, so folgt
eine Ausklingphase. Diese "Umschreibung" der Lautstärke wird in
Synthesizern von einer Hüllkurve (Envelope) übernommen. Die
klassische Hüllkurve wird in 4 zeitliche Phasen eingeteilt:
- Attack: der Ton schwingt ein bis er die höchste
Lautstärke erreicht
- Decay: der Ton wird leiser bis er die vom Instrumentalisten
gehaltene Lautstärke erreicht
- Sustain: die Haltephase mit konstantem Pegel
- Release: die Ausklingphase, die Zeit zwischen Absetzen und
Verklingen des Tons
Diese Phasen werden durch die unten stehende Abbildung
verdeutlicht.
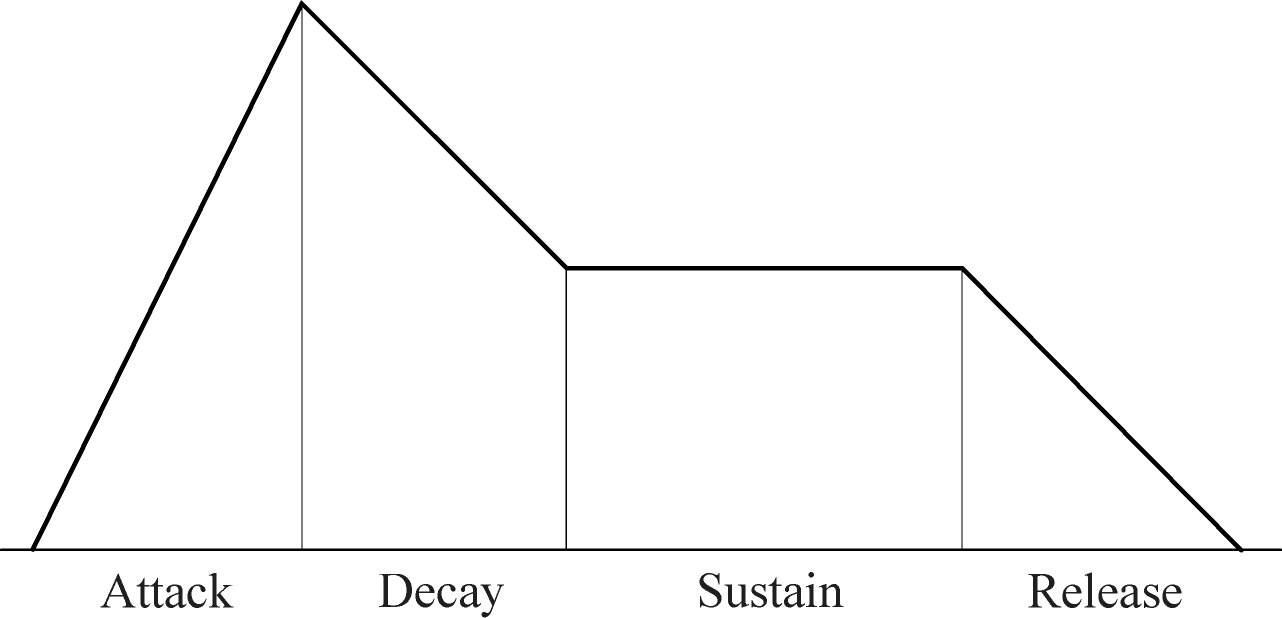
Will man unseren Sinuston mit einer Lautstärkenhüllkurve
versehen, benutzt man am besten den Befehl linseg.
instr
1
kamp
linseg 0, 0.1, 15000, 0.2, 10000, 0.6, 10000, 0.1, 0
kfrq
line 440, 1, 880
a1
oscil kamp, kfrq, 1
out 1
endin
Unser Sinuston wurde im oberen Beispiel durch eine
Lautstärkenhüllkurve erweitert. Innerhalb 0.1 Sekunden
erreicht der Sinus seine höchste Lautstärke von 15000,
schwingt innerhalb von 0.2 Sekunden auf 10000 zurück und wird
für 0.6 Sekunden auf dieser Lautstärke gehalten. Danach
verklingt der Sinus innerhalb von 0.1 Sekunden.
2. Die P-Felder
Meistens will man für unterschiedliche Töne
unterschiedliche Frequenzen, Tonlängen oder Lautstärken
verwenden. Der erste Ton soll z. B. innerhalb einer Sekunde von 440 Hz
auf 880 Hz gleiten. Der zweite Ton soll innerhalb einer halben Sekunde
von 880 Hz auf 660 Hz gleiten, usw. Es wäre umständlich, wenn
man für jeden Ton ein neues Instrument definieren müsste.
Deshalb kann man innerhalb des Orc-Files Variablen definieren, deren
Werte erst im Sco-File gesetzt werden. Ein Beispiel haben wir bei
unserem Sinus schon kennengelernt. Im Sco-File wird die Tonlänge
angegeben. Die ersten drei Parameter des Sco-
Files sind festgelegt. Der erste Parameter gibt die Nummer des zu
verwendenden Instruments an, der zweite die Startzeit, der dritte die
Tonlänge. Weitere Parameterfelder (P-Felder) können im
Orc-File definiert werden:
instr
2
ifrq1 =
p4
ifrq2 =
p5
kamp
linseg 0, 0.1, 15000, 0.2, 10000, 0.6, 10000, 0.1, 0
kfrq
line ifrq1, 1, ifrq2
a1
oscil kamp, kfrq, 1
out a1
endin
Hier werden zwei P-Felder definiert. Da die ersten drei P-Felder fest
vorgegeben sind, beginnt die Definition bei P-Feld 4, hier p4. p4 gibt
die Anfangsfrequenz an und p5 die Endfrequenz. Will man das oben
beschriebene Szenario programmieren, dann sieht unser Sco-File in etwa
so aus:
;
instr sta dur frq1 frq2
i2 0 1 440
880
i2 1 .5 880 660
e
Der erste Ton hat eine Tonlänge (dur = duration) von
einer Sekunde, beginnt bei einer Frequenz von 440Hz und endet bei
880Hz. Der zweite Ton beginnt nach einer Sekunde und dauert 0.5
Sekunden. Die Frequenz gleitet von 880Hz auf 660Hz. Die 4. Spalte gibt
also die Parameter für p4, die 5.Spalte die Parameter für p5
an, usw.
Kompiliert man die Files wird die Hüllkurve für den 2.Ton
nach einer halben Sekunde abgeschnitten. Ebenso kann das Gleiten von
880Hz auf 660Hz nicht vollständig durchgeführt werden, da im
Orc-File 1 Sekunde dafür vorgesehen wurde. Wir müssen das
Orc-File derart ändern, dass die Hüllkurve und das Gleiten
sich nach der Tonlänge richten. Die Tonlänge wird im Sco-File
als 3. Parameter (p3) definiert. Wir müssen also nur statt einer
Sekunde eine Variable, die p3 repräsentiert, einsetzen.
instr
2
idur = p3
ifrq1 = p4
ifrq2 = p5
kamp linseg 0, idur*0.1, 15000, idur*0.2, 10000, idur*0.6, 10000,
idur*0.1, 0
kfrq line ifrq1, idur, ifrq2
a1 oscil kamp, kfrq, 1
out a1
endin
Den Hüllkurvenlängen werden passende prozentuale
Längen zugewiesen. Zusammengerechnet ergibt sich die gesamte
Tonlänge: idur*0.1+idur*0.2+iddur*0.6+idur*0.1=idur.
3. Der LFO
LFO bedeutet Low Frequency Oscillator, also niederfrequenter
Oszillator. Darunter versteht man in der Regel einen Oszillator der im
unhörbaren Frequenzbereich von 0 Hz bis 20 Hz schwingt. LFOs
werden für kontinuierlich sich ändernde Klangparameter
eingesetzt, z. B. für ein Tremolo oder Vibrato. Ein Tremolo ist
ein schneller, kontinuierlicher Wechsel der Lautstärke. Das
Vibrato ist der schnelle kontinuierliche Wechsel der Tonhöhe.
In Csound verwendet man für LFOs den oscil Befehl und weist eine
entsprechend niedrige Frequenz zu. Das unten stehende Blockdiagramm
veranschaulicht den Signalfluss bei einem Tremolo.
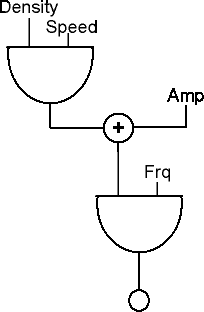
Der Amplitude wird der Wert des LFOs hinzuaddiert. Verwendet
man als Grundwellenform des LFOs einen Sinus, wird die sich durch die
Addition ergebende Lautstärke kontinuierlich lauter und leiser.
Wie oft dieser Wechsel zwischen Laut und Leise auftritt wird durch die
Frequenz des LFOs bestimmt. Bei 1 Hz haben wir einen Zyklus pro
Sekunde, bei 2 Hz zwei Zyklen, usw. Wie stark der LFO die
Lautstärke des Oszillators beeinflusst, wird durch die Amplitude
("Density") des LFOs bestimmt. Je höher die LFO Amplitude, um so
größer wird der Unterschied zwischen Laut und Leise. Es
folgt das passende Orc-File:
instr
3
idens1 = p4
ispeed1 = p5
alfo1 oscil idens1, ispeed1, 1
a1 oscil 10000+alfo1, 440, 1
out a1
endin
Die LFO Intensität und Geschwindigkeit wird im Sco-File
angegeben. Ähnlich verhält es sich, wenn man ein Vibrato
erzeugen möchte:
instr
3
idens1 = p4
ispeed1 = p5
idens1 = p6
ispeed1 = p7
alfo1 oscil idens1, ispeed1, 1
alfo2 oscil idens2, ispeed2, 1
a1 oscil 10000+alfo1, 440+alfo2, 1
out a1
endin
4. Header im Orc-File und Grundwellenform im Sco-File
Keines der in diesem Artikel veröffentlichten Listings
läßt sich so, wie es aufgeschrieben wurde, kompilieren.
Jedes Orc-File muss mit einem Header beginnen. Dort wird die
Samplingrate, Kontrollrate und Anzahl der Kanäle angegeben. Diese
Header sind hier immer gleich aufgebaut. ksmps ist immer das Ergebnis
der Division von sr/kr:
sr =
44100 ; samplingrate
kr = 4410 ; kontrollrate
ksmps = 10
nchnls = 1 ; kanalanzahl
In jedem Sco-File muß zu Anfang die Grundwellenform
für die Oszillatoren definiert werden. Dies geschieht mit dem
Befehl f. f steht für Funktionstabelle (functiontable). Es wird
dabei eine Tabelle definiert, in der die Werte eine Grundwellenform
angeben. Eine Sinusdefinition kann folgendermaßen aussehen:
f1 0
8192 10 1
Versuchen sie einmal eine andere Grundwelle, z. B. einen
Sägezahn:
f1 0
8192 7 1 8192 -1
5. Ein vollständiges Listing
Zum Abschluss dieses 2.Artikels als Hilfestellung noch das
vollständige Listing des Orc- und Sco-Files mit den LFOs:
;
orc file header
sr = 44100 ; samplingrate
kr = 4410 ; kontrollrate
ksmps = 10
nchnls = 1 ; kanalanzahl
; body
instr 3
idens1 = p4
ispeed1 = p5
idens2 = p6
ispeed2 = p7
alfo1 oscil idens1, ispeed1, 1
alfo2 oscil idens2, ispeed2, 1
a1 oscil 10000+alfo1, 440+alfo2, 1
out a1
endin
;
sco file , funktiontable
f1 0 8192 10 1
; score
; inst sta dur dens1 speed1 dens2 speed2
i3 0 1 500
1 5 2
i3 2 1 10000
2 110 10
e
Vielleicht hat ihnen der Artikel Lust auf mehr gemacht. Dann
versuchen sie doch folgende Aufgaben zu lösen:
- wie kann man ein Instrument erzeugen, dass eine
Lautstärkenhüllkurve mit von der Tondauer unabhängigen
Hüllkurvenphasen hat?
- was passiert, wenn ich den Ausgang des LFOs nicht addiere,
sondern subtrahiere, multipliziere oder dividiere?
- was passiert, wenn ich die Frequenz des LFOs erhöhe
und so in den hörbaren Bereich komme?
- wie gestalte ich ein Instrument, daß eine
Hüllkurve zur Steuerung der LFO Frequenz verwendet?
- wie gestalte ich ein Instrument, in dem ich mehrere
Grundwellen gleichzeitig verwenden will?
↑
Astyanax Retriever
Eine weitere
Veranstaltung aus der Reihe vorEcho
Am 25. Oktober 2001 fand eine weitere Veranstaltung aus der Reihe
vorEcho vom Institut für neue Musik an der Staatlichen Hochschule
für Musik in Freiburg statt, diesmal unter der Gesamtleitung von
Ludger Brümmer. Am Vor - und Nachmittag gab es Vorträge
(Claude Cadoz: "Sound Synthesis and Composition with Genesis", Annie
Luciani: "Towards Dynamic Visual Arts with Mimesis", Ludger
Brümmer: "Musikalische Organismen, Newtonsche Mechanik als
kompositorisches Mittel"), diese behandelten ein Programmpaket der
ACROE (Association pour la Création et la Recherche sur les
Outils d'Expression), das Physical Modelling, Klangsequenzierung und
dazu passende Bilderzeugung erlaubt. Siehe dazu auch:
http://acroe.imag.fr/
http://acroe.imag.fr/version-anglaise/sommairecons.html
Am Abend fand ab 20.00 Uhr ein zu den Vorträgen geradezu
illustratives Konzert statt. Mesias Maiguashca brachte sein
Tonband-Werk "Tiefen" für acht Lautsprecher, ca. 20 min., wie immer
bei Maiguashca als reine Musik im Dunkeln abgespielt. Die grundlegende
Idee war dabei die Anregung einer Metallplatte, z. B. mit einem
Geigenbogen, was mit den o. g. Methoden des Physical Modelling
umgesetzt wurde. Bei solchen Resonanzerscheinungen ist es nun so,
daß ohne starke Parameterveränderungen der Klang in der
wesentlichen Charakteristik gleich bleibt, egal wie stark der virtuelle
Bogen oder Klöppel arbeitet, so daß meiner Meinung nach die
klangliche Variabilität für ein Werk solcher Dauer etwas
gering war. Ich frage mich, ob da nicht mehr zu machen wäre.
Abweichend vom Programm kam dann Hans Peter Stubbes Rhizome,
ca. 15 min., für Harfe (Eva Reidel) und Tonband, wobei der
Tonbandpart von den Simulationen gezupfter Saiten hergeleitet war. Die
Harfenistin befand sich dabei - wie üblich - auf der Bühne
des Saales, ihr wurde per Kopfhörer ein Metronom-
Pieper zugespielt, damit überhaupt eine zeitliche Orientierung zum
Tonband möglich war, das Piepen war übrigens von meiner
Position aus die ganze Zeit gut hörbar und etwas störend. Die
Problematik der Elektroakustischen Musik trat dabei zu Tage, der
menschliche Mitspieler wird von der Elektronik dominiert, quasi ein
Sklave des Tonbandes, es ist sicherlich unmenschlich anstrengend, diese
Musik einzustudieren und aufzuführen. Ich halte dagegen die
Gelassenheit des Komponisten der Elektronischen Musik, der - wie zuvor
Maiguashca - einfach sein Band einlegt und startet, er hat alle Arbeit
in Ruhe geleistet, wie ein Maler, der sein Bild nach Fixierung und
Trocknung in Ruhe betrachtet. Letztere Haltung erscheint mir wesentlich
angenehmer und menschlicher. Soweit zur Unmenschlichkeit der
Elektronischen Musik.
Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee war, der Harfe
synthetische Saitenklänge gegenüberzustellen, vielleicht
hätte ein stärkerer Kontrast zwischen Holz und Elektronen
mehr gebracht, jedenfalls die genannten Probleme nach dem Motto
"entscheidend ist, was hinterher herauskommt" überdeckt. Leider
gab es auch einige technische Probleme in Form von Kratzgeräuschen
aus den Lautsprechern.
Nach einer Umbaupause kam als Audio/Video-Darbietung
"NochDreiSekundenSchwarz" von Hans Tutschku (Musik) und Kerstin Wagner
(Video, Darstellerin Yvonne Lachmann), ca. 10 min. Mit dem o. g.
Programmpaket wurde Audio und Video erzeugt, wobei die wesentlichen
Videoelemente (Arme, Mund und Auge) eine wirbelnde Choreographie auf
der Leinwand vollführten, wobei einige Sequenzen in mir
Assoziationen zu "Un chien andalou" von Salvador Dalí und Luis
Buñuel (1929), erweckten, natürlich in Farbe und mit den
heutigen Möglichkeiten. Eine surreale Entsprechung von Video und
Audio, einfach schön.
Den Abschluß bildete Ludger Brümers "Medusa",
für zwei Schlagzeuger (Ricardo Marini, Pascal Pons) und
Vier-Kanal-Tonband und Video, ca. 28 min. Auch hier mußte dem
Menschen eine akustische Hilfe per Knopf im Ohr zur Orientierung
gegeben werden, es gilt auch das Problem der Unmenschlichkeit. Links
und rechts von der Leinwand agierten die Schlagzeuger mit Cymbals,
Gong, Xylophon usw., während sich auf der Leinwand geometrisch
abstrakte Strukturen bildeten, sich veränderten und verschwanden.
Ganz früher, als vormittags noch kein Infotainment aus dem
Fernseher quoll, als es nur drei Programme Volksfernsehen gab, konnte
man einen sehr primitiven Vorläufer dieser Strukturen als
Pausenzeichen des WDR sehen, in ihrer fächerförmigen Gestalt
einem Hauptmotiv in der Videoproduktion entfernt verwandt. Auch hier
fehlte es mir etwas an Kontrast zwischen Schlagzeug und Tonband, das
ist vielleicht wieder mein persönliches Problem.
Ich weiß, es ist ungerecht und absolut ungerechtfertigt,
aber diese Produktion hatte etwas, sie machte einen kompakten Eindruck,
man hatte das Gefühl "das paßt", diese farbigen,
synthetischen Strukturen, immer etwas im Nebel, unscharf, abstrakt,
bedeutungslos, nicht zu interpretieren, und dazu die Musik. Für
mich der Gewinner des Abends. Wäre der Schlagzeugpart auch vom
Band gekommen, so hätte mich dies keineswegs gestört, noch
das Ergebnis wesentlich verändert, z. T. war es sowieso schwer
auszumachen, woher der Klang nun eigentlich kam.
Leider gibt es in dem großen Saal der Musikhochschule
ein Problem mit Resonanzen, irgendwelche Strukturen der Einrichtung,
oder vielleicht sogar die Parkettleisten lassen sich bei tiefen
Tönen zu schnarrenden Resonanzen anregen.
Man kann es nur immer
wieder betonen: ca. 40 Leute im Publikum ist kein Ruhmesblatt für
eine Universitätsstadt wie Freiburg mit immerhin gut 200.000
Einwohnern und für die Musikhochschule im Besonderen. Es
fanden an diesem Tag auch Prüfungen statt, die sicher irgendwie
auch unmenschlich sind, somit hatten einige Studenten und Professoren
sicherlich anderes zu tun. 12 DM Eintritt (ermäßigt sogar
nur 6 DM) sind auch kein Argument, fernzubleiben. Alle Akteure
hätten mehr Interesse verdient, keine Frage. Gerade deshalb
muß man dankbar sein, daß eine Reihe wie vorEcho weiter
besteht, Elektronische oder "elektroakustische" Musik wäre sonst
in Freiburg kaum zu hören.
↑
Torbe Reyber
Mathematik und Musik
Mathematik und Musik sind für die meisten Leute
gegensätzlich, ja unvereinbar. So ist es für manche bisweilen
eine schockierende Erfahrung, daß es schon im Altertum im
nichttrivialen Quadrivium der sieben freien Künste (Arithmetik,
Astronomie, Geometrie, Musik) Tonkunst und Mathematik in
schönster Eintracht neben- und miteinander gab, sich gegenseitig
befruchtend. In der Elektronischen Musik nun gewinnt die Mathematik
sehr stark an Bedeutung, sei es in der Komposition (Aleatorik,
Serialismus), oder in der Signalverarbeitung. Gerade im letzteren
Bereich sind die Möglichkeiten in den letzten Jahren durch die
Digitaltechnik - und das ist endliches Zahlenrechnen mit höchster
Geschwindigkeit - so enorm gewachsen, daß erfolgreiches
Produzieren ohne Grundlagenkenntnisse der beteiligten mathematischen
Prozesse mir immer mühsamer und aussichtsloser erscheint. Durch
Versuch und Irrtum wird man nicht sehr weit kommen, ja man kann
künstlerisch auf der Stelle treten, die Frustrationsgefahr
wächst. Mathematische Einsichten können da helfen. David
Hilbert hat das einmal so formuliert: "Die
Mathematik ist das
Instrument, welches die Vermittlung bewirkt zwischen Theorie und
Praxis, zwischen Denken und Beobachten: sie baut die verbindende
Brücke und gestaltet sie immer tragfähiger. Daher kommt es,
daß unsere ganze gegenwärtige Kultur, soweit sie auf der
geistigen Durchdringung und Dienstbarmachung der Natur beruht, ihre
Grundlage in der Mathematik findet". Die Beschäftigung mit
der
Mathematik ist daher äußerst lohnend für den
Produzenten Elektronischer Musik, aber was sind die Kosten? Ich
versuche hier auf wenigen Seiten einen Vorgeschmack zu geben. Jeder mag
das Opfer dann selbst einschätzen. Über einige geschichtliche
Anmerkungen komme ich zu wichtigen Grundvoraussetzungen, die dann
erlauben, nichtlineare dynamische Systeme zu untersuchen und zu
beschreiben, und das sind die Systeme, um die es bei Elektronischer
Musik vor allem geht.
Denkweise und Geschichte
Für mich ist die Mathematik eine reine
Geisteswissenschaft, denn
sie behandelt rein geistig abstrakte Konstruktionen und deren
Beziehungen untereinander. Denn es gibt in der Natur keine Kreise,
keine Zahlen, keine Matrizen, keine Vektoren, keine Mengen.
Im geschichtlichen Ablauf war dies nicht immer so deutlich, da
die Entwicklung von Mathematik und Physik Hand in Hand vonstatten ging,
oft in Personalunion z. B. eines Isaac Newton, nach den jeweiligen
praktischen Erfordernissen. Dadurch gab es ein gewisses Durcheinander,
das dann in einem Revisionsprozeß im 19. und 20. Jahrhundert
bereinigt wurde, um die gesamte Mathematik auf ein solides, geordnetes
und logisches Fundament zu stellen. Um diese Zeit gab es schon wichtige
Ergebnisse, die keinerlei praktische Anwendung hatten, also reine
Mathematik, und es ist seitdem immer mehr geworden. Wie in jeder
anderen Disziplin findet eine Aufspaltung in verästelte Gebiete
statt, in denen sich nur eine kleine Zahl von Experten auf der ganzen
Welt auskennt.
Ich muß den Leser also zunächst enttäuschen,
in der Schule haben wir nur etwas Arithmetik, etwas Geometrie, etwas
elementare Algebra und wenn es gut ging auch etwas Analysis gelernt, aber das ist
nicht Mathematik, sondern das sind nur wichtige Teilergebnisse der
klassischen Mathematik vor nunmehr fast 300 Jahren. Alles was danach
kam ist meist deutlich schwieriger und den praktischen Anforderungen
meist weiter entrückt. Das hat natürlich auch Vorteile: wenn
die für uns praktisch wichtige Mathematik so alt ist, so wird sie
allgemein gut verstanden sein, werden die Ergebnisse solide und
abgesichert sein und es wird eine entwickelte Didaktik geben.
"Ein Grund für die
spezielle Wertschätzung der
Mathematik über alle anderen Wissenschaften hinaus ist, daß
ihre Gesetze absolut sicher und unanzweifelbar sind, während die
der anderen Wissenschaften immer zu einem gewissen Grad unsicher sind
und zudem in stetiger Gefahr sich befinden, von neuen Tatsachen
komplett entwertet zu werden" (Albert Einstein). Hier tritt eine
einzigartige Eigenschaft der Mathematik zu Tage. Was sind
physikalische, medizinische, chemische, musikalische, astronomische
oder archäologische Theorien von vor 300 Jahren heute noch wert?
Wenig oder meist nichts! Der Satz des Pythagoras ist nun ca. 2500 Jahre
alt, aber er besteht immer noch, und daran wird sich auch nichts
ändern. Die alten Griechen haben nämlich den
öffentlichen Beweis in die Mathematik eingeführt, und zwar in
wesentlich strengerer Form als den "Beweis" vor Gericht.
Es gibt gewisse vernünftige Grundannahmen (Axiome)
über die man sich verständigt, ebenso über die Regeln
des richtigen Schließens (Logik). Ab diesem Punkt kann ein
mathematischer Beweis von allen Fachleuten Schritt für Schritt
kritisch diskutiert und nachvollzogen werden, jedes Glied der
Beweiskette muß dabei standhalten, sonst fällt alles in sich
zusammen. Dies ist eine totale Abkehr von der religiösen
Geheimwissenschaft der ägyptischen und babylonischen
Mathematik-Priester-Praktiker, die zwar Rezepte hatten, aber meist
nicht wußten, warum sie funktionierten [1]. "Ich meine das Wort
Beweis nicht im Sinne der Juristen, die zwei halbe Beweise einem ganzen
gleichsetzen, sondern im Sinne der Mathematiker, wo ein halber Beweis
nichts ist und wo für einen Beweis verlangt wird, daß jeder
Zweifel unmöglich ist" (Carl Friedrich Gauß).
Seither sind Axiome die Grundlage eines mathematischen
Bereiches, darauf gründen sich per strengem Beweis die Sätze
(Theoreme, also bewiesenermaßen wahre Aussagen), und
Hilfsätze. Über allem thront die mathematische
Logik, die festlegt, was eigentlich ein Beweis ist. Es gibt zwar auch
Vermutungen, diese sind aber nur Ansporn, den Beweis für die
Richtigkeit der Vermutung zu führen, die Suche mag Jahrhunderte
dauern, niemand wird jedoch in der Mathematik etwas auf Vermutungen
aufbauen.
Deshalb gibt es in der Mathematik eigentlich nur Evolution,
keine Revolution. Tausende Jahre alte Ergebnisse sind und bleiben
gültig. Freilich hat diese ungebrochene Tradition insofern ihre
Nachteile, als daß es implizite Festlegungen gibt, die die
Insider gar nicht mehr als solche erkennen. Das Symbol
für die Zahl Pi ist noch jedem bekannt, aber e als Basis des
natürlichen Logarithmus, x, y und z für die drei kartesischen
Raumkoordinaten, allgemein x für die unabhängige Variable, a,
b und c für Parameter, die ganzen Operatoren und sonstigen
Symbole, sie sind alle fast 300 oder gar mehr Jahre alt.
Euklid war ein guter Lehrer, er hat sein Geometriewerk "Die
Elemente" vor 2300 Jahren lehrbuchmäßig in Strenge
entwickelt, und so wird im wesentlichen heute noch gelehrt. Dazu
stellte er zunächst vier Axiome auf:
- Zwischen zwei Punkten kann eine Strecke gezeichnet werden.
- Jede Strecke kann unendlich verlängert werden (man hat
also eine
Gerade).
- Für jede Strecke gibt es einen Kreis mit der Strecke
als Radius
und einem Endpunkt der Strecke als Mittelpunkt des Kreises.
- Alle rechten Winkel sind deckungsgleich (kongruent).
Und dazu ein fünftes Axiom:
- wenn man eine Gerade zeichnet und einen Punkt, der nicht
auf der
Geraden liegt, so gibt es genau eine Gerade, nämlich die
Parallele, die durch diesen Punkt geht, und die Ausgangsgerade nie
schneidet.
Hier sieht man schön die geistige Abstraktion: es gibt
keine
materiellen Punkte und Geraden, weder mit Schnur und Kreide noch mit
Tinte. Ja, es gibt noch nicht einmal die perfekte Ebene, die Euklid
voraussetzte. Sie sehen an diesem Beispiel auch, wie fundamental Axiome
sind. Im genannten Revisionsprozeß hat man die Sache noch einmal
ganz genau geprüft und festgestellt: Euklid hatte einige
zusätzliche Grundannahmen - die ihm völlig evident erschienen
- gar nicht erst erwähnt. Aus der modernen Sicht - 2300 Jahre
später - hat die Erfahrung die Mathematiker dazu bewogen, diese
Lücken zu stopfen, die Euklidische Geometrie z. B. nach Hilbert
hat demnach 20 Axiome, was am Endergebnis jedoch gar nichts
ändert, denn Euklid hatte die richtigen Schwerpunkte gesetzt, die
Mängel waren also eher formaler Natur.
Das fünfte Axiom ist nun merkwürdig, es erscheint
weniger zwingend als seine vier Vorgänger. Daher versuchte man
lange, die Aussage des fünften Axioms aus den vier anderen heraus
zu beweisen, was aber unmöglich ist. Was kann man sonst tun? Was
passiert, wenn man am fünften Axiom des Euklid ändert? Solch
frevelhaftes Denken war erst lange nach der Aufklärung im 19.
Jahrhundert möglich und man kam zu zwei weiteren vollgültigen
Geometrien: eine mit unendlich vielen Parallelen, und eine andere ohne
jegliche Parallele im euklidischen Sinn.
Wir haben also im Bereich der Geometrie drei unterschiedliche
Theorien, die sich durch das fünfte Axiom unterscheiden, jede mit
eigenen Lehrsätzen und untereinander unvereinbaren Aussagen, jede
ist für sich logisch und widerspruchsfrei. Welche ist nun "die
Richtige"? Diese Frage läßt sich innerhalb der Mathematik
nicht beantworten. Man kann sich aber fragen, welche für die
Physik am geeignetsten erscheint. Die Erde ist beinahe eine Kugel,
Euklids Geometrie der Ebene stimmt also hier bei langen Strecken nicht,
z. B. bei der Planung von Flugrouten.
Damit kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, dem der
Interpretation. Innerhalb der Mathematik hantieren wir nach bestimmten
Regeln mit Symbolen, z. B. Ziffern in der Arithmetik. Ob eine Operation
korrekt ist, oder nicht, läßt sich leicht entscheiden. Dann
aber kommt die Interpretation des Ergebnisses. Nehmen wir ein einfaches
Beispiel: 5 + 4 = 8. Wenn wir "=" als "gleich" interpretieren, so ist
die Aussage falsch. Wenn wir es aber als "größer oder
gleich" interpretieren, so ist die Aussage richtig. Wir müssen
also über eine widerspruchsfreie Interpretation unseres
Formalismus verfügen. D. h.: wir müssen eine praktische, z.
B. physikalische Fragestellung zuerst in einen geeigneten
mathematischen Formalismus abbilden, sozusagen die richtige Mathematik
dafür aussuchen, dann lassen wir den Formalismus ablaufen, das
Ergebnis jedoch müssen wir jedoch wieder außermathematisch
interpretieren. Wenn der gewählte Formalismus nicht paßt,
werden wir keine sinnvolle Interpretation der Ergebnisse finden
können und umgekehrt. "Wie kann
es sein, daß die Mathematik
als Produkt reinen menschlichen Denkens, und somit unabhängig von
der Erfahrung, so bewundernswert zu den Objekten der Realität
paßt?" (Albert Einstein).
In der Schule wird viel Zeit mit Rechnerei verbracht,
außerdem werden die Ebenen der Abbildung, des Formalismus und der
Interpretation ständig unreflektiert vermischt, infolgedessen
scheitern die meisten bei der Abbildung oder bei der Interpretation.
Formales Rechnen ist Fleißarbeit, man kann es durch Fleiß
zu etwas bringen. Die beiden anderen Bereiche erfordern jedoch
Einsicht, Fleiß genügt hier nicht. Dies mag für viele
die wesentliche Hürde beim Lernen gewesen sein.
Das solchermaßen errichtete Gebäude der Mathematik
sieht recht solide aus, aber gibt es auch vielleicht versteckte Risse?
Ja, die gibt es. Genau wie die Physik 1927 mit
Heisenbergs Unschärferelation an eine fundamentale Grenze
stieß, so geschah es in der Mathematik, als Gödel 1932
seinen Unvollständigkeitssatz bewies. Dieser besagt, daß
jedes mathematische System mit seinen Axiomen, Sätzen, Beweisen
und Interpretationen entweder unvollständig ist, also nicht alle
möglichen Wahrheiten beinhaltet, oder aber in sich selbst
widersprüchlich ist. 1932 war dies ein Schock, heute hat man sich
an limitative Ergebnisse dieser Art in den Wissenschaften schon
längst gewöhnt [2].
Das Vorausgegangene war ein Versuch, unter den Schuttbergen
aus Hausaufgaben, Auswendiglernen, Rechenschiebern, Tabellenwerken und
zweifelhaften Lehrbüchern das Wesen der Mathematik noch einmal
auszugraben. Ich möchte nun an konkreten Beispielen einige
wichtige Ergebnisse und Methoden kurz ansprechen, die für die
Elektronische Musik von äußerster Wichtigkeit und von
größtem Nutzen sind, dabei wird auch eine Vermischung der
drei Ebenen Abbildung, Formalismus und Interpretation stattfinden.
Komplexe Zahlen
Im folgenden werden wir in der Praxis sehen, daß es
nützliche und interessante mathematische Bereiche außerhalb
der üblichen Schulbildung gibt. In der Schule vollziehen wir ja
gleichsam die Menschheitsgeschichte am Individuum nach, wir starten mit
den Natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, ..., die sicher schon vor 6000
Jahren gedanklich entwickelt waren, wie z. B. Zahlenschnüre
beweisen. Hinzu kommt dann die Zahl 0, dann Negative Zahlen und somit
die Ganzen Zahlen ... , -3, -2, -2, 0, 1, 2, 3, ..., dazu dann die
Brüche, also haben wir die Rationalen Zahlen.
Schon um 2500 v. u. Z. kannte man die Irrationalen Zahlen, wie
z. B. die Quadratwurzel aus 2 und die Transzendenten Zahlen wie Pi. Die
gesamte Menge all dieser genannten Zahlen bildet die Menge der Reellen
Zahlen, so genannt, weil sie "dicht genug" beieinanderliegen um
jeglichen Meßwert und jedes Rechenergebnis aus der realen Wert
auszudrücken. Aber die Reellen Zahlen reichen nicht, denn wenn Sie
in der Schule eine Aufgabe zu lösen hatten, bei der am Ende die
Wurzel aus einer negativen Zahl zu berechnen war, so konnten sie sicher
sein, einen Fehler gemacht zu haben. Die Wurzel aus einer negativen
Zahl kann man doch nicht ziehen, der Taschenrechner sagt: "ERROR",
oder? Nun ist es so, daß schon ganz einfache Gleichungen dadurch
recht merkwürdig werden. Betrachten wir das folgende Beispiel:
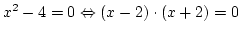
Gesucht ist als die Lösung einer einfachen Quadratischen
Gleichung, die gleich äquivalent umgeformt in Produktform daneben
steht. Es gibt also offensichtlich zwei Lösungen, 2 und -2.
Probieren Sie es aus! Jetzt verändern wir die Gleichung ein klein
wenig:
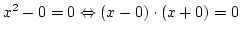
Die Konstante wurde von -4 auf 0 abgeändert, dies ist
trivial und ergibt 0 als doppelte Lösung, wie die Produktform
zeigt. Nun ändern wir die Konstante auf 1 und es gibt scheinbar
überhaupt keine Lösung mehr:

Denn welche Zahl x ergibt mit
sich selbst multipliziert -1, also eine negative Zahl und hebt damit
die Konstante 1 weg zu Null?
Quadrieren und Quadratwurzelziehen sind zueinander inverse
Operationen. Ich kann jede Relle Zahl quadrieren, aber nur aus den
positiven Rellen Zahlen die Wurzel ziehen. Dies ist merkwürdig.
Und: die Terme auf der linken Gleichungsseite waren Polynome, also
Ausdrücke der Form:
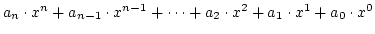
wobei die an feste Zahlenwerte sind, die sogenannten
Koeffizienten. Polynome sind praktisch sehr wichtig, wir werden dies
später noch behandeln. Es ist daher nicht einzusehen, daß
solche Nullstellenprobleme mit Polynomen - wie oben gezeigt - manchmal
n, manchmal aber gar keine Lösung haben sollen. Offenbar hat die
Mathematik hier eine Lücke.
Jetzt kommt eine typisch mathematische Vorgehensweise: man
identifiziert genau das Fehlende. Im gezeigten Beispielfall ist es die
Quadratwurzel aus -1. Alle anderen Fälle lassen sich darauf
zurückführen. Wir wissen, daß diese Wurzel
normalerweise nicht existiert, denn welche Zahl ergibt mit sich selbst
multipliziert etwas Negatives? Deshalb stopfen wir die Lücke,
indem wir genau dies hinzufügen, wir sagen einfach: "Die Wurzel
aus -1 existiere, es sei die Zahl i, die imaginäre Einheit". Es
gilt damit auch per Definition:

Damit ist die Produktform des letzten Problems:
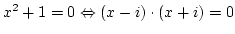
also ist die
Lösung -i und i.
Wir kommen somit zu einem erweiterten Zahlenbegriff, dem der
Komplexen Zahlen. Eine solche Zahl z setzt sich aus einer
gewöhnlichen reellen Zahl a, dem Realteil, sowie einer reellen
Zahl b, dem Imaginärteil, mal der imaginären Einheit i wie
folgt zusammen:

Ist a gleich Null, so ist z rein imaginär. Ist b
gleich Null, so ist z rein reell. Alles dazwischen ist komplex. Das
Wunderbare an dieser Erweiterung des Zahlenbegriffes ist nun, daß
sie konservativ ist, alles bisher Gelernte über Arithmetik und
Algebra gilt weiterhin, man muß nur stets die Regeln beachten.
Lassen Sie uns das ganze einmal geometrisch in der Ebene des Euklid
betrachten. Die natürlichen Zahlen lassen sich auf dem
Zahlenstrahl abtragen. Ich erinnere mich noch an meinen ersten
Schultag, als ich diesen Zahlenstrahl, das ganze Klassenzimmer
umlaufend, erblickte, von 1 bis 10000. Wir wissen, daß es auch
negative Zahlen gibt, diese brauchen einen negativen Bereich, also
benötigen wir eine Zahlengerade wie in der Abbildung:
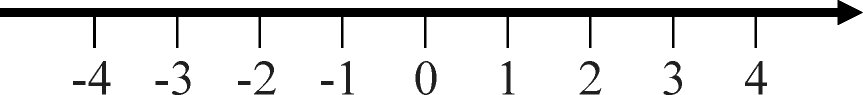
Die Reellen Zahlen, die uns helfen, die Physik abzubilden,
sind beliebig "feinkörnig", sie liegen dicht überall auf dem
Zahlenstrahl. Die komplexen Zahlen lassen sich nicht mehr auf einer
Zahlengeraden unterbringen, sondern sie bedürfen der komplexen
Zahlenebene. Die Reelle Zahlengerade ist dort natürlich mit
eingeschlossen. Betrachten wir dazu die folgende Abbildung:
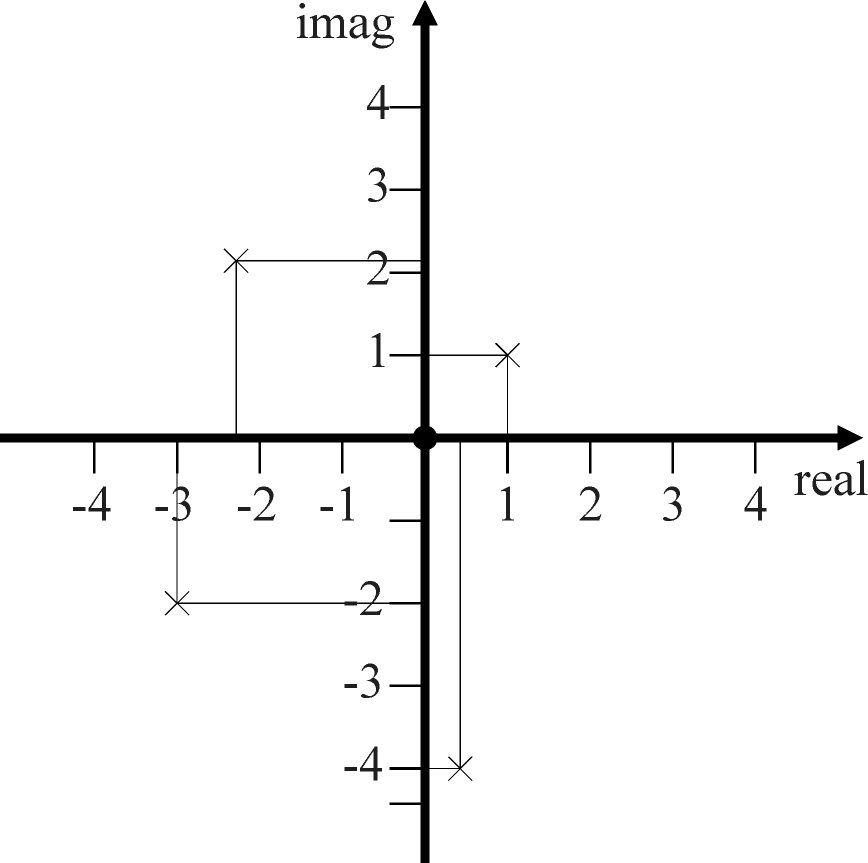
Die rein rellen Zahlen liegen dabei auf der rellen Achse (z.
B. -3 oder 2.1). Die rein imaginären Zahlen liegen auf der
imaginären Achse (z. B. 2i, -4i). Ich habe vier komplexe Zahlen
eingezeichnet, zusammen mit deren Abtragungen auf den Achsen (0.4-4i,
1+1i; -2.2+2.1i; -3-2i).
Sie sehen, daß man bei komplexen Zahlen von einer Relation wie
"größer" oder "kleiner" nicht mehr sprechen kann, denn es
gibt in der Ebene nur links, rechts, oben und unten. Man kann aber den
Betrag einer komplexen Zahl angeben, und das ist der Abstand vom
Nullpunkt der Zahlenebene, oder nach Pythagoras und den vorher
eingeführten Bezeichnungen:
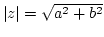
Sie sehen: alles kehrt wieder, nichts
ist in der Mathematik verloren. Dies alles wäre jetzt völlig
uninteressant, wenn es für unsere Zwecke keine passende
Interpretation gäbe. Komplexe Zahlen können jedoch
sinusförmige Schwingungen sinnvoll repräsentieren, sie sind
unentbehrlich bei der Berechnung von Frequenzgängen, Filtern und
der Lösung von Differentialgleichungen. Schließlich kann man
mit ihnen die wunderbaren Apfelmänchen der chaotischen
Mandelbrot-Menge berechnen, oder die Figuren der Julia-Menge.
Funktionen
Bisher waren die Lösungen einer Gleichung gesucht, und
das waren
Zahlen, ob nun reell oder komplex, jedenfalls punktuelle
Größen ohne Ausdehnung. Die uns interessierenden
Größen wie die elektrische Spannung U oder der relative
Schalldruck p, oder aber auch eine Melodielinie lassen sich aber in
ganz natürlicher Weise als Funktionen der Zeit beschreiben. Man
schreibt z. B. p(t). Was bedeutet das? Die Funktion p(t) kann man sich
als unendliche Tabelle vorstellen, in der für jeden Zeitpunkt t
(die Variable) genau ein Druckwert p(t) (der Funktionswert) eingetragen
ist, z. B. durch eine ideale Messung. In der Abbildung habe ich solch
eine Tabelle für einige
Meßwerte einmal angelegt:
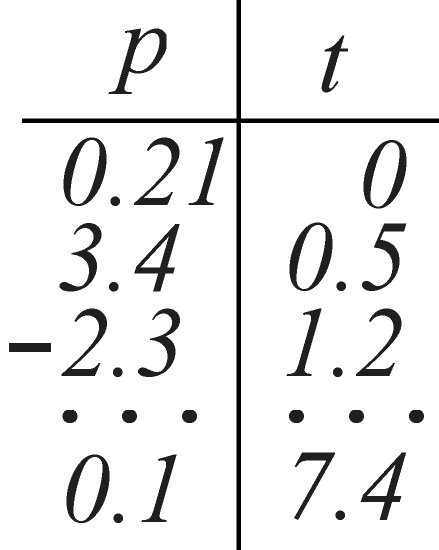
Die Zeit könnte dabei z. B. in Sekunden gemessen werden,
der Druck in Pascal. Die Idee, daß für wirklich jeden
Zeitpunkt t ein Meßwert eingetragen ist und sei er noch so fein
aufgelöst, läßt sich dabei nur schwerlich darstellen.
Es ist auch möglich, p(t) für negative Zeiten einzutragen,
was üblicherweise die Vergangenheit symbolisieren soll. Es gibt
aber auch Funktionen die nur zu ganz bestimmten Variablenwerten (sprich
Zeiten) einen Wert aufweisen, Sound-
Sampling läßt sich so beschreiben. Zum Schluß kann die
Variable nicht nur die Zeit, sondern z. B. den Ort, die Temperatur oder
andere physikalische Größen beschreiben.
Anstatt durch eine Tabelle kann man Funktionen einfacher durch
eine Rechenvorschrift oder Formel beschreiben, dies ist sogar der
übliche Weg. Also:
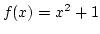
Dies ist die bekanntere Darstellung, f(x) als Funktion der Variablen x.
Die Formel besagt nun, daß für jede Zahl x diese zum Quadrat
zu nehmen ist und 1 hinzu zu addieren ist, um dann den Funktionswert
für diese Zahl x zu erhalten. Die Formel als Rechenvorschrift
für alle x beinhaltet somit die unendliche Tabelle in sich, und
dies in handlicher Form.
Der dritte, und vielleicht anschaulichste Weg, sich einer
Funktion zu nähern ist der Funktionsgraph. Man trägt die
Werte der Variablen und die entsprechenden Funktionswerte als Punkte in
ein Diagram ein. Sie kennen das Verfahren schon von den Graphen der
Börsenkurse her. Für die Beispieltabelle mit vier Werten habe
ich dies durchgeführt, vollziehen Sie dies einmal nach:
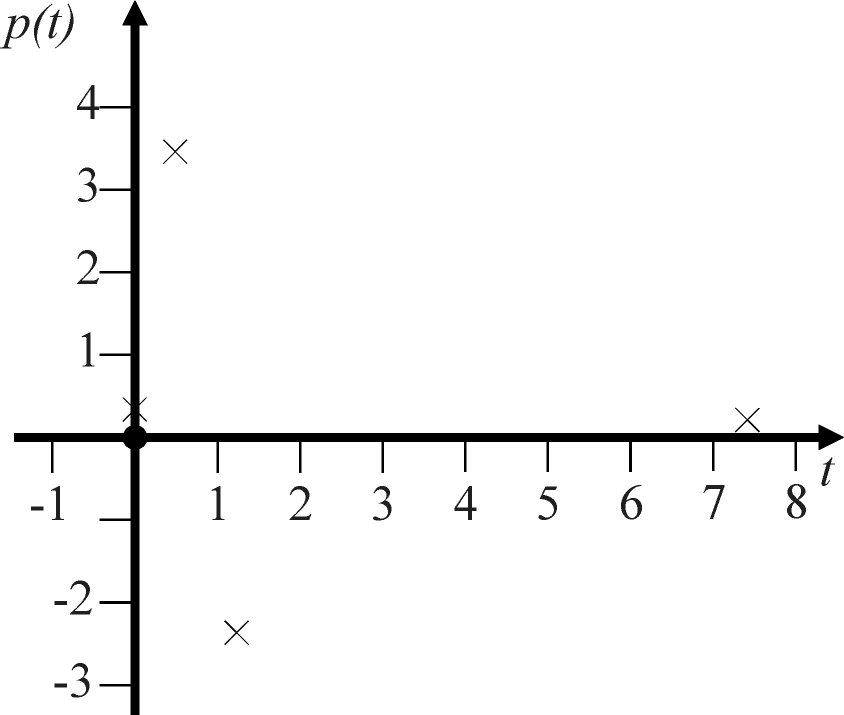
Für mehr Werte wird dies lästig, aber wozu haben wir
schließlich Computer? Es gibt ein kostenloses Program namens
Gnuplot zur Berechnung der Graphen unter: http://www.gnuplot.info/.
Dort findet man auch eine Menge Zusatzprogramme und Tutorials. Das
folgende Beispiel für die Funktion (2) habe ich mir von Gnuplot
ausrechnen lassen:
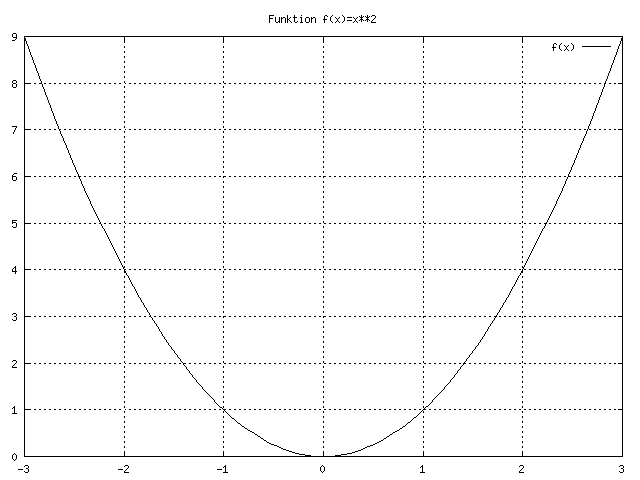
Wie für die Zeichnungen in der Geometrie, so
gilt auch für Funktionsgraphen: Man darf ihnen nicht zu sehr
trauen und man kann nichts mit ihnen beweisen. Denn wenn wir bei
unserem Bild der Funktion ahnungslos "wichtige" Punkte weglassen, oder
zu grob auflösen, können wir ein in wesentlichen
Eigenschaften falsches Bild der Funktion bekommen. Das physische Bild
hilft sehr beim Nachdenken, kann die geistige Analyse aber niemals
ersetzen.
Quellen:
[1] Simon Singh : Fermat's Last Theorem : Petersen, Hamburg; Fourth
Estate
[2] Douglas Hofstadter : Gödel, Escher, Bach : Ernst Klett Verlag
↑
Rückseite

|